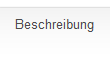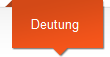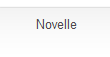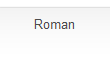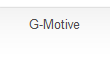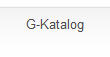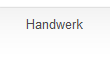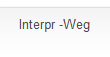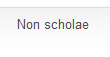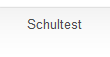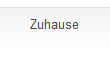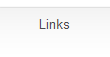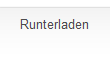|
|
|
|
|
Interpretation der Gedichte „Ebenbild unsers Lebens“ und „Die Welt“ A. Der Gedichtvergleich in der Oberstufe
Teil I. Andreas Gryphius (1616 - 1664) Sonette. Das Erste Buch XLIII.
Ebenbild unsers Lebens. Auff das gewöhnliche Königs-Spiel.
DEr Mensch das Spil der Zeit / spilt weil er allhie lebt. Im Schau-Platz diser Welt; er sitzt / und doch nicht feste. Der steigt und jener fällt / der suchte der Paläste / Vnd der ein schlechtes Dach / der herrscht und jener webt. Was gestern war ist hin / was itzt das Glück erhebt; Wird morgen untergehn / die vorhin grüne Aeste Sind numehr dürr und todt / wir Armen sind nur Gäste Ob den ein scharffes Schwerdt an zarter Seide schwebt. Wir sind zwar gleich am Fleisch / doch nicht von gleichem Stande Der trägt ein Purpur-Kleid / und jener grabt im Sande / Biß nach entraubtem Schmuck / der Tod uns gleiche macht. Spilt denn diß ernste Spil: weil es die Zeit noch leidet / Vnd lernt: daß wenn man von Pancket des Lebens scheidet: Kron / Weißheit / Stärck und Gut / bleib ein geborgter Pracht.
In seinem Gedicht „Ebenbildt unseres Lebens“ beschreibt1 der Dichter Andreas Gryphius die Ungleichheit der Menschen, welche sich in der unterschiedlichen Lebensweise ausdrückt, und die Vergänglichkeit aller Dinge. Es fällt auf, dass keine Kommata verwendet, sondern an deren Stelle Schrägstriche gesetzt werden. Auch die Rechtschreibung unterscheidet sich teilweise sehr stark von der heutigen, z.B. „schau-platz“ (zweite Zeile) und „purpur-kleidt“ (zehnte Zeile). Manche Wörter werden an verschiedenen Stellen sogar unterschiedlich geschrieben, z.B. „spiel“ (Z 1) und „spiell“ (Z 12). Dies ist verständlich, wenn man bedenkt, dass es früher noch keine einheitliche Rechtschreibregelung gab (werkexternes Wissen). Da dieses Gedicht aus zwei Verszeilen, den Quartetten, und zwei Dreizeilern, den Terzetten, besteht, was man auf den ersten Blick wegen der fehlenden Stropheneinteilung nicht erkennen kann, handelt es sich um ein Sonett. Als Versmaß lässt sich der Jambus erkennen, d.h. die erste Silbe ist unbetont, die zweite betont. Der Vers hat sechs Hebungen und eine Zäsur nach der dritten Hebung, sodass sich ein Alexandriner ergibt. Diese Merkmale zeigen, dass es sich bei der Entstehungszeit des Gedichts um das Barock handeln muss, denn Sonett und Alexandriner sind typisch für diese Epoche. Zieht man die Lebenszeit des Dichters hinzu (Andreas Gryphius lebte von 1616 bis 1664), ist jeder Zweifel ausgeschlossen (werkexterne Betrachtung).
Das Reimschema der Quartette ist jeweils ein umschließender Reim (a b b a), das der Terzette ein Schweifreim (c c d, e e d). Da nur wenige Zeilensprünge vorkommen, nämlich von der dritten zur vierten, von der sechsten über die siebte zur achten und von der neunten über die zehnte zur elften, wirkt das Gedicht nicht langatmig oder langweilig. In der letzten Zeile des Gedichts des zweiten Terzetts kommt es zur Zuspitzung, zur Pointe: kron/ weisheit/ stärcke und gutt/ sei eine leere pracht. Hier „beschreibt“ der Dichter die Nichtigkeit materieller Güter und der Lebensanschauung der Menschen, denn all diese Dinge können einem Menschen in tiefer Not nicht helfen.
Um die werkimmanente Untersuchung verständlicher zu gestalten. gehe ich jetzt auf die externen Gegebenheiten ein. Andreas Gryphius wurde zwei Jahre vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges (1618 -1648) geboren. So erlebte er schon in frühster Kindheit die Qualen der Bevölkerung und die Grausamkeiten der Soldaten. Zudem verlor er seine Eltern sehr früh. Der Dichter hatte also keine glückliche Kindheit, vielmehr prägten seine schlechten Erinnerungen sein Leben und Wirken. Man findet seine düsteren Lebenserfahrungen in all seinen Gedichten wieder. Die Lebensauffassung der Barockliteratur steht im Vordergrund. Zum einen „Vanitas“ (Eitelkeit, Nichtigkeit), wie auch schon im Titel des vorliegenden Gedichts zu finden ist, und „Memento mori“ (Denke an den Tod), zum anderen „carpe diem“ (Genieße den Tag; wer weiß, wie lange du noch lebst.) Es fällt auf, dass Gryphius oft als Stilmittel die Antithetik (Gegensätzlichkeit), eine beliebte Form im Barock, wählt, um seine Ausführungen zu verdeutlichen. Die erste Zeile des ersten Quartetts weist eine solche Antithetik, die meistens nach der Zäsur folgt, auf: „Der Mensch das spiel der zeit/ spielt weil er allhie lebt“. Gryphius will mit der Umschreibung „spiel der zeit“ das Leben ausdrücken, welches für ihn nur ein Spiel und nichts Gewichtiges darstellt. Es ist ein Spiel auf Zeit, weil die Lebenszeit begrenzt ist. Der Mensch wird geboren, ohne gefragt zu werden, ob er überhaupt in einer so entbehrungsreichen Zeit leben will. Weil er aber nun ohne sein Wollen auf der Welt ist, muss er hier auch leben. Es stehen sich also die Vergänglichkeit (spiel der zeit) und das Diesseits (weil er allhie lebt) gegenüber. In der zweiten Zeile drückt Gryphius die Nichtigkeit und Eitelkeit der Menschen mit der Metapher „schauplatz dieser Welt“ aus. Er vergleicht die Welt mit einem Schauplatz, auf dem jeder jeden beobachtet, auf dem „gelästert“ wird und wo man anderen die eigene Vollkommenheit und Besonderheit vorspielt. Die Antithetik „er sitzt und doch nicht feste“ bestätigt diese Metapher. Man meint, die Geltung vor anderen sei das Wichtigste; in Wirklichkeit aber zählen diese Dinge nicht, da der Mensch nicht sein wahres Gesicht zeigt. (Der Vers entlarvt nur die Selbsttäuschung vermeintlicher Sicherheit. Die gesicherte Position ist angesichts äußerer Unsicherheitsfaktoren nur Selbstbetrug; Ad) Auch in der dritten Zeile arbeitet der Dichter deutlich mit Antithetik: Der steigt und jener fällt“. Das Auf und Ab des Lebens ist gefährlich für den Menschen: Ein falsches Wort oder eine falsche Tat und das Glück ist vorbei. Die dritte und vierte Zeile zusammen bilden durch die Antithetik einen Chiasmus (Überkreuzstellung); im zweiten Teil der dritten Zeile steht: „ der suchte der paläste“; im ersten Teil der vierten Zeile: „und der ein schlechtes Dach“. Diese Aussage beziehen sich auf die vorige der steigt und jener fällt. Wer Glück hat, enthält demnach einen guten Platz im Leben (Palast), wer Pech einen schlechten. Das Wort „Paläste“ steht hier für einen Platz in der Nähe des Herrschers, welcher Reichtum und Macht garantiert, also nichtige, aber für das gesellschaftliche Leben so notwendige Dinge. Das „schlechte Dach“ steht für ein Leben in Armut, ohne Anerkennung. Hier lässt sich der Untertitel des Gedichts „Auff das gewöhnliche Königs-Spiel“, welcher das Schachspiel meint, zum Vergleich heranziehen. Es gewinnt, wer Glück hat und richtig handelt, genauso wie im Leben. (Beim Schachspiel geht es um Machtvorteile, nicht um Glück – Schachspieler wissen das; Ad) Da Gryphius das Spiel königlich nennt, misst er ihm einen Wert bei, denn jeder Mensch hält an seinem Leben fest, auch wenn es unglücklich ist. Ebenso bedeutet ein Platz in der Nähe des Königs, wie schon erwähnt, Anerkennung. In den ersten drei Zeilen des zweiten Quartetts arbeitet der Dichter ebenfalls mit Antithetik. Er stellt das Gestern und Morgen gegenüber, um die Vergänglichkeit aller Dinge herauszuheben. Besonders deutlich wird dies am Beispiel: Die vorhin grüne Aeste Sind nunmehr dürr und todt“. Die grünen Äste als Sinnbild des Lebens, sind jetzt schon abgestorben, obwohl sie vorhin noch grünten. Dies drückt die Schnelligkeit aus, mit der der Tod kommen kann. Gryphius bezieht sich selbst mit ein, wenn er schreibt wir Armen sind nur Gäste“ und in der nächsten Zeile Ob den ein scharffes Schwerdt an zarter Seide schwebt, welches die Bedürftigkeit der bedrohten Armen ausdrücken soll. Die achte Zeile nimmt Bezug auf das Schwert des Damokles, welches über den Köpfen der Menschen schwebt. Manchmal fällt es herab und tötet einen Menschen.
In den Terzetten kritisiert Gryphius die Klassifizierung in Stände: Wir sind zwar gleich am Fleisch / doch nicht von gleichem Stande und führt dies fort: Der trägt ein Purpur-Kleid / und jener grabt im Sande. Hier wird klar, zu welchem Stand Gryphius gehört: weder zu den ganz Armen noch zu den Reichen. Hiermit führt er die Unterschiedlichkeit der Stände auf, mahnt aber in der elften Zeile: Biß nach entraubtem Schmuck / der Tod uns gleiche macht. Gryphius appelliert an die Reichen, des „memento mori“ zu gedenken, denn vor Gott seien alle Menschen gleich. Die Periphrase „entraubter Schmuck“ stellt das Leben dar. Da Schmuck für Prunk und Macht steht, haben die Reichen viel, die Armen wenig zu verlieren. Das letzte Terzett mit der Pointe am Schluss stellt die Lehre des Gedichts dar: Vnd lernt: daß wenn man von Pancket des Lebens scheidet: Kron / Weißheit / Stärck und Gut / bleib ein geborgter Pracht. Hier führt der Dichter das aus, was er schon im ersten Terzett angedeutet hat: Die irdischen (materiellen) Werte gelten nach dem Tod nichts, es zählen nur Gesinnung und Taten der Menschen. So ist dieses Gedicht für das Barock typisch; „memento mori“ wird in den Vordergrund gestellt als Mahnung für die Reichen; die Vanitas spielt hier eine geringere Rolle. Es ist ein Appell: Für die Reichen ist es eine Mahnung, für die Armen ein Trost.
Teil II
Interpretation und Vergleich
Christian Hofmann von Hofmannswaldau (1617 – 1679) Die Welt
WAs ist die Lust der Welt? nichts als ein Fastnachtsspiel / Es gehet uns wie dem / der Feuerwercke macht /
Das Gedicht „Die Welt“ des Dichters Christian Hofmann von Hofmannswaldau stellt den Sinn des Lebens in Frage, denn alles, was man als wichtig betrachtet, scheint fragwürdig, wird verlacht oder als vergänglich ausgewiesen. Es beginnt mit einer Frage, die dann ausführlich beantwortet wird. Der erste Teil dieser Antwort wirkt etwas langatmig, da sie aus einem sich über vier Zeilen erstreckenden Satz besteht. Weitere Zeilensprünge bestehen von der neunten zur zehnten, von der elften zur zwölften und von der neunzehnten bis zur zwanzigsten Zeile. Obwohl der Dichter wie auch Andreas Gryphius im Barock lebte (werkexterne Kenntnis), hat dieses Gedicht nicht die Form eines Sonetts. Es besteht aus fünf vierzeiligen Strophen, also fünf Quartetten. Das Versmaß ist jedoch ebenso wie bei Gryphius ein sechshebiger jambischer Vers mit Zäsur nach der dritten Hebung: ein Alexandriner. Als Reimschema lässt sich ein Kreuzreim (a b a b) erkennen, wobei in jeder Strophe andere Wörter miteinander reimen. Nur die erste und dritte Zeile des letzten Quartetts reimen mit der ersten und dritten Zeile des zweiten Quartetts. - Die Rechtschreibung unterscheidet sich nicht sehr von unserer heutigen, aber auch hier werden wie im Gedicht des Gryphius anstelle von Kommata Schrägstriche verwendet. Die Frage Was ist die Lust der Welt?, mit der sich H .v .Hofmannswaldau am Anfang beschäftigt, scheint zunächst nichts mit dem Titel „Die Welt“ gemeinsam zu haben. Bei ihrer Beantwortung jedoch lässt sich erkennen, dass der Zustand auf der Welt und somit auch die Welt beschrieben wird. Zunächst gibt der Dichter in der ersten Zeile eine Antwort: nichts als ein Fastnachtsspiel. Der Welt wird keine besonders positive Aufgabe zugemessen, denn mit Fastnachtsspiel assoziiert man Verkleidung, Oberflächlichkeit und Unbekümmertheit. Die zweite Zeile drückt durch ihre Antithetik Vergänglichkeit aus: So lange Zeit gehofft / in kurtzer Zeit verschwindet Die Vorfreude auf ein besonderes Ereignis dauert meist sehr lange, auf die Fastnacht z.B. ein ganzes Jahr, während die eigentliche Dauer des Ereignisses oft nur wenige Stunden beträgt. Danach sieht die Welt wieder aus wie vorher; doch viele Menschen möchten, dass diese Zeit der Freude noch länger andauert. Jedoch wie der Dichter schreibt Da unsre Masquen uns nicht hafften / wie man wil / ist dieser Wunsch nicht erfüllbar. Die Masken der Fastnacht passen sich nicht mehr den Rundungen und der Form des Kopfes an, sodass sie nicht mehr sitzen. Die Leute, die dennoch versuchen, die Masken zu tragen, werden bloßgestellt, wenn sie ihnen plötzlich herunterfallen und ihr wahres Gesicht zum Vorschein kommt. So ist es auch im Leben: Fällt einem Menschen eines Tages die Maske ab, mit der er seine Idealvorstellungen von einem Menschen an sich selbst verwirklichen wollte, und seine wirklichen Taten kommen zum Vorschein, ist er nicht mehr glaubwürdig und er hat das Spiel verloren. H. v. Hofmannswaldau gibt in der zweiten Strophe ein weiteres Bild für Vergänglichkeit: ein Feuerwerk. Ein Augenblick verzehrt offt (!!) eines Jahres Sorgen; Der Mensch soll also nicht nur seine Nöte und Ängste sehen, sondern auch den schönen Augenblicken einen gewissen Wert beimessen, sie aber nicht in den Vordergrund stellen. In der siebten Zeile stellt der Dichter ein wohl für Eltern sehr schmerzliches Erlebnis dar: Man schaut wie unser Fleiß von Kindern wird verlacht. Eltern, die viel entbehren und für ihre Kinder viel arbeiten, damit ‚sie es einmal besser haben als wir’, erleben eine große Enttäuschung, wenn ihre Kinder sie deswegen nicht Ernst nehmen. So wird, was für die nächste Generation auch noch existieren sollte, nichtig und vergänglich. Aber auch schon ein Tag kann schnell zunichte gehen, wie Hofmannswaldau mit der Personifikation in Zeile acht Der Abend tadelt offt den Mittag und den Morgen. andeutet - das Existenzlimit einer Sache, kurz oder lang. (Gemeint ist hier wohl eher die Kurzlebigkeit des Erfolges; Ad). Der Dichter führt diese Einsicht in den ersten beiden Zeilen des dritten Quartetts fort: Wir fluchen offt auf dis was gestern war gethan / Wir kennen uns / und dis / was unser ist / offt nicht und Zeile 15 Man merckt / wie unser Wuntsch ihm selber widerspricht / spricht u.a. Modeerscheinungen an. Man mag vor allem das, was zurzeit gefragt und wozu Lust vorhanden ist. Ein „Muss“ wird nicht gern angenommen, weil es Zwang bedeutet. Hier kommt die natürliche Faulheit des Menschen hervor. Im letzten Quartett fasst der Verfasser seine gewonnen Erkenntnisse noch einmal zusammen mit der Metapher in Zeile 18 Ein grosser Wunderball mit leichtem Wind erfüllet. Obwohl das Gedicht von der Form her nicht unbedingt typisch für das Barock ist, so ist es aber doch sein Inhalt, denn es wird die Vanitas-Vorstellung auf der Erde deutlich. Iris Dierking © LK GBE 9/1983 Lehrerkommentar: Ihre umfangreiche Arbeit (!) belegt werkimmanente und werkexterne Sachkenntnisse. Am Schluss hätten Sie vielleicht noch die unterschiedliche Bearbeitung des Vanitas-Motivs in beiden Barock-Gedichten akzentuieren können. Aber dennoch: Sehr gelungen – sehr gut!
Die Sympathie von Schülern mit dem Begriff „Beschreibung“ hat wohl Tradition. (s. Link) Aber mein Lob hätte doch ruhig etwas euphorischer ausfallen dürfen.
B. Das Vanitas-Sonett in der Mittelstufe
Andreas Gryphius: Ebenbild unsers Lebens Drei Interpretationen aus Kl.9 - GBE 10/ 20006
1. In dem Sonett „Ebenbild unsers Lebens“ von Andreas Gryphius geht es um den Tod, der arme und reiche Menschen gleichsetzt. Nach meinem ersten Textverständnis will mir der Autor mit diesem Text zeigen, dass es egal ist, in welchen Verhältnissen man lebt. Nach dem Tod sind Arme genau wie Reiche. Im Folgenden werde ich meine Deutungshypothese am Text überprüfen.
Das vorliegende Gedicht ist ein Sonett, da es vier Strophen hat: zwei Quartette mit vier und zwei Terzette mit drei Versen. Es weist einen sechshebigen Jambus mit einer männlichen Kadenz auf und hat nach drei Hebungen eine Zäsur, die vom Druckbild her nur durch ein Komma hervorgehoben wird. Es handelt sich um einen Alexandriner. Der Text ist in einem Wechsel von Präsens und Präteritum verfasst, da er eine Sicht in die Vergangenheit vollzieht. Das Reimschema ist in den Quartetten abba abba, also ein umarmender Reim. In den Terzetten wechseln die Reime jedoch zu ccd und eed, also zu einem Schweifreim. Die Zwischenüberschrift „Auf das gewöhnliche Königsspiel“ deutet auf eine Gleichheit zwischen dem Herrscher und seinen Untertanen hin, da mit dem Königsspiel das Schachspiel gemeint ist, welches die Herrscher gemeinsam mit den Bauern spielen. Beim Sieg des Bauern ist er dem Herrscher nicht mehr unterlegen, sondern mit ihm gleichgesetzt, da er nun die gleichen Ehren in seinem Figurenbeutel erfährt. 1 Das wird auf das Leben zwischen Arm und Reich übertragen, da alle nach dem Tod die gleiche Ehre haben. Somit ist dieses Sonett ein Vanitas-Gedicht, welches Andreas Gryphius häufig benutzt hat.
In Zeile 1 findet sich eine Metapher „Spiel der Zeit“, welche klar verdeutlicht, dass das Leben vergänglich ist, was auch mit einem Beispiel gezeigt wird: “Die vorhin grünen Äste sind nunmehr dürr und tot.“ (Z 6/7). Bei einem Spiel kann man gewinnen, aber es gibt immer auch ein Spiel, das man verliert; so ist das wahrscheinlich mit dem „Spiel der Zeit“ gemeint. Man kann gewinnen, also weiterleben; aber man kann auch einmal verlieren, also dem Tod begegnen. Und dieses „Spiel“ wird jedem widerfahren, egal ob reich oder arm. Der Autor hebt die Unterschiede zwischen Arm und Reich deutlich heraus, indem er Unterschiede zeigt, z.B. „Der trägt ein Purpurkleid, und jener gräbt im Sande“ (Z 10). An der Syntax ist mir aufgefallen, dass es keine kurzen Sätze gibt, die eine Zeile umfassen, sondern nur lange Sätze, die durch Kommas in Haupt- und Nebensätze unterteilt sind und „verschachtelt“ wirken, z.B. „Der Mensch, das Spiel der Zeit, spielt weil er allhie lebt/ Im Schauplatz dieser Welt; er sitzt, und doch nicht feste.“ (Z 1-2). Es gibt noch weitere Enjambements, z.B. „ … die vorhin grüne Äste/ sind nunmehr dürr und tot; …“ (Z 6-7). Auffällig ist, dass fast alle Strophen nur einen Satz umfassen. Außerdem geht die erste Strophe nicht mit einem Satzende, sondern mit einem Semikolon in die zweite Strophe über. Es werden Wörter benutzt, die in unserem heutigen Sprachgebrauch nicht mehr vorkommen (z.B. „Itzt“ Z 5).
Im Text ist auch Antithetik vorhanden, z.B. „Leben“ /Z 13) und „Tod“ (Z 11). In der vierten Strophe erinnert das lyrische Ich die Menschheit daran, dass die Herrscher nach dem Tod ihre Macht verloren und somit die gleiche Stellung haben wie die Untertanen. Diese Gleichheit wird durch „Kron, Weisheit, Stärk und Gut bleib ein geborgter Pracht“ (Z 14) verdeutlicht.
Der Ausdruck „Spiel der Zeit“ taucht zweimal im Text auf, was darauf hindeutet, dass es sehr wichtig für den Textzusammenhang ist (Z 1 – Z 12). Um den Klang (bzw. Rhythmus und Versmaß) gut zu bewahren, hat Andreas Gryphius bei manchen Wörtern Buchstaben ergänzt, z.B. „Stande“ (Z 9) und auch welche weggelassen, z.B. „bleib“ (Z 14).
Nach meiner gründlichen Textanalyse kann ich die Deutung des Anfangs beibehalten, muss aber noch ergänzen, dass es für die Menschen nicht entscheidend ist, ob sie reich oder arm sind; schließlich verfällt die Macht des Herrschers nach dem Tod und er hat die gleichen Rechte wie eine ärmere Person. Insa Ellermann © - GBE Kl. 9 (S.Wiese) 10/ 2006 1 Hier ließe sich ergänzen, was Schachspieler wissen: Könige können im Schach ihre Macht verlieren und Matt gesetzt werden, selbst durch die Kraft eines “wertloseren” Bauern. (Ad)
2. In dem Sonett „Ebenbild unseres Lebens“ von Andreas Gryphius geht es um die Vergänglichkeit aller Dinge und darum, dass alle, egal ob arm oder reich, nach dem Tod gleich sind. Nach meinem ersten Textverständnis soll der Text aussagen, dass es im irdischen Leben zwar große Unterschiede zwischen Armen und Reichen gibt, man aber als armer Mensch das Leben trotzdem genießen sollte, da es schnell vorübergeht und nach dem Tod alle gleich sind.
In der ersten Strophe wird das Leben der Menschen als „das Spiel der Zeit“ dargestellt und verdeutlicht, dass es im Leben unterschiedlich wohlhabende Leute gibt. In der dritten Strophe wird dann noch mal aufgeführt, dass die Menschen alle „am Fleisch gleich“ sind, aber zu unterschiedlichen Ständen gehören. Dies wird besonders durch die Antithetik veranschaulicht, zum Beispiel: „Der steigt und jener fällt“ (Z 3) und „ der herrscht, und jener webt“ (Z 4). In Strophe zwei wird fast ausschließlich von der Vergänglichkeit gesprochen, zum Beispiel: „Was gestern war, ist hin; was itzt das Glück erhebt, wird morgen untergehen;“ (Z 5-6) Durch die Formulierung „wir Arme sind nur Gäste“ (Z 6) soll gezeigt werden, dass niemand ewig auf Erden bleiben kann, sondern irgendwann gehen muss. Auch in Zeile 2 wird gesagt: „er sitzt, und doch nicht feste.“, was auf den Menschen bezogen ist. Daher ist dies ein Vanitas-Sonett. In der letzten Strophe ruft dass lyrische Ich durch einen expliziten Appell dazu auf, das Leben zu genießen unter dem Vorwand, dass das Leben kurz ist und schnell vorbei sein kann. Man soll sich deshalb auch bewusst sein, dass alle begehrten Dinge wie „Kron, Weisheit, Stärk und Gut“ (Z 14) nach dem Tod keinen Wert mehr haben. An dem Satz „Bis nach entraubtem Schmuck der Tod uns gleiche macht“ (Z 11) kann man erkennen, dass in diesem Gedicht besonders von der Gleichheit der Menschen nach dem Tod gesprochen wird.
Dieses Gedicht hat 14 Verse, die aus zwei Quartetten und zwei Terzetten bestehen, was auf ein Sonett schließen lässt. Das Metrum ist ein sechshebiger Jambus mit einer Zäsur nach der dritten Hebung, Die Kadenz und das Reimschema in Strophe 1 und 2 ist 6wa, 6wb, 6wb, 6wa; für Strophe 3 : 6wc, 6wc, 6wd und für Strophe 4: 6we. 6we, 6wd. Diese Form wird auch Alexandriner-Metrum genannt. Das Gedicht ist im Präsens 1 geschrieben und hat einen altertümlichen Sprachgebrauch. Es gibt Metaphern „Im Schauplatz dieser Welt“ (Z 2), „Bankett des Lebens“ (z 13) und „Ob den’ ein scharfes Schwert an zarter Seide schwebt“ (Z 8). In diesem Satz steht das scharfe Schwert möglicherweise für den Tod und die zarte Seide für das Leben.
Aufgrund meiner Textanalyse kann ich meine Deutungshypothese beibehalten, sollte aber noch ergänzen, dass Andreas Gryphius - als Dichter auch selbst vom Krieg betroffen - dieses Gedicht geschrieben hat, weil es für die Menschen im 30 -jährigen Krieg und für die Opfer der Seuchen wichtig war, zu wissen, dass nach dem Tod alles besser wird. Auch für die armen Leute war es ein Trost, dass bei Gott alle Menschen gleich sein werden. Zum Titel kann man vermuten, dass es sich beim „Ebenbild des Lebens“ um das Schachspiel handelt, da es mit den Schachfiguren ähnlich wie mit den Menschen ist. 2
Annika Henschen © - GBE Kl. 9 (S.Wiese) 10/ 2006
Alternativen zu den deutenden Überlegungen aus einem gelungenen dritten Aufsatz: 1. Das Gedicht verwendet überwiegend Präsens, manchmal wird aber auch die Vergangenheit „Was gestern war“ (z 5) oder die Zukunft „wird morgen untergehen“ (Z 6) beschrieben. 2 „Das Sonett hat einen Untertitel, der den Titel erklärt „Auf das gewöhnliche Königsspiel“. Erst dadurch wird klar, worauf der Titel „Ebenbild unsers Lebens“ sich bezieht: auf die Ähnlichkeit des Schachspieles mit unserem Leben, da auch die Figuren gleich sind, nachdem sie geschlagen wurden. Dazu passt, dass „das Spiel des Lebens“ zweimal in dem Gedicht vorkommt (Z 1; 12). Das Sonett handelt von der Vergänglichkeit des Lebens, ist also ein Vanitas- Gedicht. Oft kommt Antithetik vor: „die vorhin grüne Äste – sind nunmehr dürr und tot“ (Z 6 -7). Diese Antithetik findet sich selten in einem Vers, sondern wird auf zwei Verse aufgeteilt. Solche Zeilensprünge nennt man auch Enjambements. Was auffällig ist, dass in der ersten Strophe von „Der Mensch“ gesprochen wird (Z 1), in der dritten wird nun von „wir“ gesprochen (Z 9) und in der letzten Strophe werden die Leser selbst angesprochen: „Und lernt“ (Z 13). Mit diesem Appell wird erklärt, dass man im Tod alles verliert, was man hat, und dass es keinen Unterschied macht, ob man arm oder reich ist. Deshalb muss man ein gottgefälliges Leben führen, um nach Verlassen des „Banketts“ (Z 13) zu Gott zu kommen. Nach meiner Textanalyse kann ich meine erste Deutungshypothese beibehalten, muss aber hinzufügen, dass der Autor an den Leser appelliert, ein gottgefälliges Leben zu führen, das dieses irdische Leben nicht so wichtig ist wie das Leben nach dem Tod. Olimpia Dabkowska © Kl.9 (S. Wiese) 10/ 2006 zum gleichen Thema –
An diesem Aufsatz kann man auch lernen, wie eine Anfangshypothese am Schluss sinnvoll überdacht wird. (Ad) Lyrikschadchens barocker PDF –Druck
|
|
|