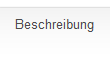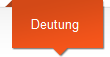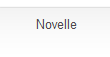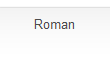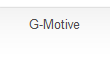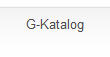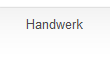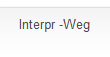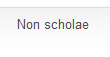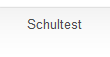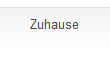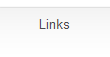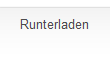|
|
|
|
|
These und Beispiel: Unterricht am GBE beseitigt Interpretationsnebel Alfred Lichtenstein (1889 - 1914)
Nebel Ein Nebel hat die Welt so weich zerstört. Blutlose Bäume lösen sich in Rauch. Und Schatten schweben, wo man Schreie hört. Brennende Biester schwinden hin wie Hauch.
Gefangne Fliegen sind die Gaslaternen. Und jede flackert, daß sie noch entrinne. Doch seitlich lauert glimmend hoch in Fernen Der giftge Mond, die fette Nebelspinne.
Wir aber, die, verrucht, zum Tode taugen, Zerschreiten knirschend diese wüste Pracht. Und stechen stumm die weißen Elendsaugen Wie Spieße in die aufgeschwollne Nacht.
(1913)
Alfred Lichtenstein (1889 bis 1914) verfasste 1913 das Gedicht „Nebel“. 1 Der Dichter schildert in seinem Gedicht auf eine beklemmende Weise die Natur, die Umgebung, den Mensch und sein Auftreten im Nebel. Im ganzen macht das Gedicht einen beklemmenden Eindruck. Dies passt gut zu Nebel, da dieser bei vielen Menschen ein seltsames, eventl. beängstigendes, bedrückendes Gefühl auslöst. Außerdem wurde das Gedicht 1913 geschrieben. Die politische Situation in Europa und somit auch in Deutschland war zu dieser Zeit sehr unruhig. Kaiser Wilhelm II. betrieb eine sehr „wackelige“ Politik, undurchschaubare Außenpolitik. Der 1. Weltkrieg stand vor der Tür. Auch diese Situation mag Lichtenstein sehr berührt und ihm sämtliche Hoffnungen genommen haben, was sich auch auf die Stimmung des Gedichtes auswirken würde.
Das Gedicht selbst ist in drei vierzeilige Strophen eingeteilt. In Strophe I liegt ein 5-hebiger Jambus vor, der nur am Anfang der Zeile 4 durch einen unregelmäßigen Trochäus unterbrochen wird. Die zweite Strophe ist ähnlich gestaltet: ein 5-hebiger Jambus mit überzähliger Senkung zieht sich durch die gesamte Strophe und wird auch hier nur am Anfang der vierten Zeile durch eine doppelte Senkung nach dem ersten Jambus gebrochen. Auffällig ist Strophe drei; hier liegt in der ersten Zeile ein 4-hebiger Jambus mit überzähliger Senkung am Ende und zwei Hebungen am Anfang der Zeile vor, während sich in Zeile zwei und vier wieder ein 5-hebiger Jambus findet. Das Reimschema ist in jeder Strophe ein Kreuzreim (abab). Die Kadenzen folgen dagegen einem anderen Schema: Strophe I hat nur männliche, Strophe II nur weibliche Kadenzen (mmmm; wwww). In Strophe III wechseln sich weibliche und männliche Kadenzen ab (wmwm). Der Zeilenstil ist in allen Strophen zu finden. Lediglich in Strophe II und III sind jeweils die Zeilen drei und vier durch ein Enjambement verbunden. Auffällig ist außerdem die häufige Nutzung der Oxymora (I, 1: „die weißen Elendsaugen „), der Personifikation (z.B. I, 2: „Blutlose Bäume“) und der Verdinglichung (z.B. II, 1/2).
Die innere Form des Gedichts lässt sich in drei Teile aufteilen, die auch den Strophen entsprechen. In Strophe I beschreibt Lichtenstein die Natur, wie sie im Nebel erscheint, in Strophe II kommen dann die Tiere und die ersten menschliche Einflüsse (z.B. II,1: „Gaslaternen”) hinzu, während in Strophe III schließlich der Mensch zerstörend hinzutritt. Lichtenstein möchte mit seinem Gedicht „Nebel“ eine Warnung an die Menschen aussprechen, denn meiner Meinung nach stellt Lichtenstein dar, dass der sowieso zum Tode verurteilte Mensch, der die Natur zum Leben braucht, in diese eingreift und sie zerstört, ohne das Recht dazu zu haben. Die erste Strophe des Gedichtes beschreibt, wie die Natur im Nebel erscheint: alles ist nur noch andeutungsweise zu erkennen (I, 1), die Farbe verschwindet im Nebel und scheint grau. Diese Beschreibung lässt sich gut in Zeile 2 erkennen: die Personifikation „Blutlose Bäume“ lässt die Farblosigkeit der Natur im Nebel erahnen, da Blut den Menschen Farbe gibt, ohne Blut aber alles bleich und farblos wirkt wie eben die Natur im Nebel. Dieses gräulich-farblose, verschwommene Bild wird auch durch die Metapher „Rauch“ (I, 2) verstärkt, denn hier wird der Nebel mit Rauch gleichgestellt und auch dieser verhüllt Dinge. Doch der Nebel verhüllt nicht nur die Natur, sondern er verdeckt auch negative, eventuell Angst einflössende Dinge, was man in den Zeilen drei und vier sehen kann: „und Schatten schweben, wo man Schreie hört. Brennende Biester schwinden hin wie Hauch.“. Der Nebel verhüllt also diese negativen Erscheinungen (Schreie) nicht nur, sondern er lässt sie mit der Zeit sogar verschwinden („Brennende Biester schwinden hin wie Hauch.“, I, 4). Die Natur ist also sehr ruhig und friedlich dargestellt; ebenso wird hervorgehoben, dass sie sehr gut alleine zurechtkommt, ohne den Menschen, auch wenn mal „Probleme“ (I, 3/4) auftreten. Diese Ruhe und Friedlichkeit wird durch lange, weiche Vokale ebenso unterstrichen wie durch die regelmäßig angewandten Stilmittel: durchgehend männliche Kadenzen, Zeilenstil, Kreuzreim, fast durch die gesamte Strophe gehender 5-hebiger Jambus. Die zweite Strophe greift jetzt Tiere und einige Eingriffe der Menschen in die Natur mit auf. Der Mensch wird sozusagen als falscher Freund dargestellt: er stellt die in II, 1 benannten Gaslaternen auf, um nachts mehr sehen zu können, obwohl doch die Natur selbst eine „Lampe“ für die Nacht hat, den Mond. Die hellen Gaslaternen ziehen in der Dunkelheit die Fliegen an, die dann in den Gaslaternen gefangen sind und umherschwirren, da sie nur selten wieder herausfinden. Dass die Gaslaternen also nicht in die Natur gehören, wird auch durch die Verdinglichung in Zeile 2 deutlich. Hier heißt es: „Und jede flackert, dass sie noch entrinne“ , wobei sich das „jede“ auf die Fliegen bezieht. Das Flackern einer Flamme wird also auf die wirr umherschwirrenden Fliegen übertragen. Liest man die Zeilen drei und vier der zweiten Strophe zum ersten Mal, so mag man denken, der Mond sei eine Bedrohung für die Fliegen („Doch seitlich lauert hoch in Fernen / Der giftige Mond, die fette Nebelspinne.“, II.3/4). Schaut man sich aber die Zeile drei genauer an, so lässt sich dieser Eindruck durch ein in Zeile drei auftretendes Oxymoron widerlegen, denn dort heißt es, der Mond würde den Fliegen auflauern. Lauert man aber jemandem auf, so ist man nahe an seinem Opfer dran. Doch in Zeile drei wird von „in Fernen“ gesprochen. Der Mond stellt also keine Bedrohung dar. Im Gegenteil wären die Fliegen ohne Gaslaternen im Mondlicht nicht in eine solche Falle getappt. Strophe zwei stellt also dar, was für Folgen an Tier und Umwelt die Eingriffe der Menschen in die Natur mit sich bringen; die Lebensart der Menschen passt nicht zu der Lebensart der Tiere und zu dem Kreislauf der Natur allgemein. Dies wird zum einen durch das Oxymoron in Zeile drei („seitlich lauert glimmend hoch in Fernen“) unterstrichen. Zum anderen wird diese, durch die Menschen verursachte Unruhe auch durch die unregelmäßiger werdenden Stilmittel betont: So sind in Strophe zwei viele kurze Vokale und Doppelkonsonanten zu finden („flackert“, „entrinne“, II.2 ; „glimmend“, II,3 und „fette Nebelspinne“,II,4). Zu dem Zeilenstil in den ersten Zeilen kommt ein Enjambement von der dritten auf die vierte Zeile und auch das Metrum ist anders als in der ersten Strophe: es liegt ein 5-hebiger Jambus mit überzähliger Senkung vor, wobei diese überzählige Senkung auch noch einmal die Überflüssigkeit des Menschen betont. In der dritten Strophe tritt schließlich der Mensch direkt auf. Hier wird am besten deutlich, dass der Mensch die Natur zerstört, da er nicht zu ihr passt und sie daher nicht versteht. Unterlegt wird dies vor allem von den vielen Oxymora („Zerschreiten knirschend diese wüste Pracht“, III, 2 und „die weißen Elendsaugen“ III, 3). Die Menschen tun zwar so, als ob sie anmutig durch die Natur „schreiten“ (III, 2) würden, doch sie tun es nicht wirklich, denn niemand „schreitet knirschend“. Der Mensch erkennt die Natur und damit auftretende Erscheinungen wie den Nebel nicht als schön, sondern eher als beängstigend/bedrückend. Wir sehen nicht, dass auch und vielleicht gerade der Nebel etwas Schönes, Beruhigendes, Friedliches hat. Wir, die Menschen, halten uns oft für vollkommen und klug, doch wir übersehen dabei, dass die Natur ohne den Menschen klarkommt, die Menschen aber nicht ohne die Natur leben können und dass die Natur immer älter wird als jeder einzelne Mensch, denn jeder Mensch, jeder von uns, muss sterben, die Natur nicht. Trotz dieser Tatsachen nimmt sich der Mensch das Recht, die Natur zu zerstören oder in sie einzugreifen. Er verbreitet Unruhe und Unfrieden (Z.3/4). Dieses wird anhand der Stilmittel unterlegt: in der Strophe drei tauchen die meisten Oxymoron auf (III, 2; III, 3), außerdem wurden viele Zisch- und Knurrlaute verwendet, wie z.B. in Zeile zwei „wüste Pracht“ und in Zeile drei „weißen Elendsaugen“. Das in den Strophen eins und zwei relativ regelmäßige Metrum wird in Strophe drei häufig unterbrochen; der Zeilenstil wird in Zeile drei durch ein Enjambement abgelöst und auch die Kadenzen sind nicht mehr einheitlich männlich oder weiblich, sondern wechseln sich ab. Die inhaltliche Unruhe wird also durch unregelmäßig bzw. durcheinander angewandte Stilmittel unterstrichen.
Insgesamt kann man sagen, dass sich meine Interpretationshypothese bestätigt hat. Die Problematik wurde in diesem Gedicht sehr gut und geschickt dargestellt, jedoch ist vieles erst auf den zweiten Blick zu erkennen.
Kira Wessel © GBE 20002 Kl. 11 (Abram) Anm: 1 Frühste Datierung: Handschrift Nr. 122/ (05.01.1913) Erstdruck im Simplicissimus 18. Nr. 32 (03.11.1913)
II.
Analysieren und interpretieren Sie Alfred Lichtensteins Gedicht „Nebel“.
1. Einleitung 2. Gesamteindruck des Textes 3. Klärung des Verstehenshorizontes 4. Textbeschreibung 5. Interpretationshypothese und Deutung (linear oder aspektorientiert)
In dem Gedicht „Nebel“, das 1913 von Alfred Lichtenstein (1889-1914) verfasst wurde, geht es um eine vom Nebel verhüllte Welt, in der nur noch die zum Tode verurteilten Menschen umherwandern, ohne aus ihr fliehen zu können. Das gesamte Gedicht hat eine negative Wirkung. Es wirkt düster und verbreitet eine Endzeitstimmung. Mit Nebel wird oft auch verborgene Gefahr assoziiert. In dem Gedicht hat man ebenfalls das Gefühl einer im Nebel lauernden Gefahr. Das Gedicht wurde zur Zeit des Expressionismus geschrieben. Die Texte dieser Zeit sind sehr geprägt von der damaligen Krise der bürgerlichen Gesellschaft und der Verachtung gegenüber dem technisch-ökonomischen Nützlichkeitsdenken und den imperialistischen Eroberungsträumen. Die charakteristische Darstellung von Verfall, Untergang und Weltende scheint auch Lichtenstein in seinem Gedicht zu thematisieren.
Das Gedicht ist in drei Quartette (vierzeilige Strophen) aufgeteilt. Das Versmaß der ersten Strophe ist recht unregelmäßig. So folgen im zweiten und vierten Vers auf die erste Hebung zwei Senkungen (einhebiger Daktylus), danach ein vierhebiger Trochäus. Der erste und dritte Vers haben einen fünfhebigen Jambus mit Auftakt. Alle Verse enden mit einer männlichen Kadenz. Alle vier Verse der zweiten Strophe haben einen fünfhebigen Jambus (mit überzähliger Senkung und weiblicher Kadenz. Der erste Vers der dritten Strophe beginnt wieder mit einem einhebigen Daktylus und endet mit einem vierhebigen Jambus mit überzähliger Senkung. Die Verse 2-4 haben einen fünfhebigen Jambus. Vers 1 und 3 enden mit einer weiblichen, Vers 2 und 4 mit einer männlichen Kadenz. Das Reimschema aller drei Strophen ist der Kreuzreim.
Von der inneren Form her ist das Gedicht in zwei Teile aufgeteilt. Während in den Strophen I, die die Verhüllung durch den Nebel thematisiert, und II, die von der vergeblichen Flucht vor dem Nebel handelt, das Geschehen eher aus der Distanz betrachtet wird, verengt sich die Perspektive in Strophe III, die das Verhalten der Menschen im Nebel darstellt, auf „wir“ (I,1). Auffällig sind vor allem die Antithesen und Oxymora, z.B. „weich zerstört“ (I, 1) und Vergleiche und Metaphern, z.B. „Blutlose Bäume“ (I, 2) und „Brennende Biester schwinden hin wie Hauch“ (I, 4). Außerdem befindet sich in Strophe I, 4, Strophe II, 2 und 4 und Strophe III, 1 jeweils eine Zäsur. In den Strophen II und III findet sich je ein Enjambement in den Versen 3 und 4. Alfred Lichtenstein könnte mit seinem Gedicht seine Verachtung gegen die damaligen Lebensformen bzw. die Gesellschaft und die geringe Hoffnung auf Rettung darstellen wollen. Im Folgenden soll nun das Gedicht in Hinblick auf die Interpretationshypothese interpretiert werden.
Gleich im ersten Vers der Strophe I hat Lichtenstein ein Oxymoron („weich zerstört“) verwendet. Der Begriff „weich“ könnte in diesem Fall auch für schleichend bzw. unbemerkt stehen. Etwas ist so unauffällig gekommen und hat die Welt zerstört wie der Nebel, der ja oft plötzlich da ist, ohne dass jemand bemerkt hat, wann und wie. Ist er dann da und versperrt die Sicht auf die Umwelt, ist es zu spät, ihm noch zu entkommen. Zudem hat Lichtenstein statt „der Nebel“ „ein Nebel“ geschrieben. Dies macht ihn noch bedrohlicher, denn dadurch wird deutlich, dass der Nebel unbekannt und somit auch unberechenbar ist. Der zweite Vers lautet: „Blutlose Bäume lösen sich in Rauch“ (I, 2). Blutlos ist oft mit blass, bleich gleichzusetzen. Die Bäume sind derart vom Nebel verschleiert, dass sie blass wirken. Schließlich werden sie ganz vom Nebel verdeckt. Dieses Sinnbild könnte die Vereinsamung des Menschen symbolisieren. Die Gesellschaft unterdrückt das Individuum, bis es schließlich isoliert und somit mehr oder weniger unsichtbar ist. Der dritte und vierte Vers machen deutlich, dass auch die letzten Aufständischen am Ende klein beigeben müssen. Denn dort, wo es noch letzte (Auf-)Schreie gibt, verwischt der Nebel alles zu Schatten. Die Gesellschaft verschleiert sozusagen alles Negative und zum Schluss verschwinden die Revolutionäre „wie Hauch“ (I, 4), das heißt ähnlich wie der Hauch, der vor dem Mund entsteht. Der letzte verbale Widerstand verfliegt, sobald er gesprochen wurde. Strophe II verdeutlicht, wie unmöglich es ist, sich aus den Fängen der Gesellschaft zu befreien. Die Verse 1 und 2 lauten: „Gefangne Fliegen sind die Gaslaternen./Und jede flackert, dass sie noch entrinne.“ Hier werden die Gaslaternen, die durch ihr Flackern versuchen, durch den Nebel hindurch gesehen zu werden, mit in einem Spinnennetz gefangenen Fliegen verglichen bzw. personifiziert. Auch Fliegen versuchen durch Bewegung aus dem Netz zu fliehen, ohne zu merken, dass sie sich dabei immer mehr verfangen. Die Unmöglichkeit des Vorhabens wird in den Versen 3 und 4 beschrieben: „Doch seitlich lauert glimmend hoch in Fernen/(!) Der giftige Mond, die fette Nebelspinne.“ Durch das Wort „doch“ wird schon am Anfang alle Hoffnung vertrieben. Der Mond will sozusagen kein anderes Licht neben sich und verdrängt das Licht der Laternen. Die Spinne wartet nur darauf, die Fliegen zu fressen. Hier symbolisieren Mond und Spinne die höheren Klassen bzw. die Reichen und Mächtigen (z.B. Fabrikbesitzer), die auf jeden Fall den Aufstieg sozial Schwächerer verhindern wollen. Die ärmeren Schichten werden im Gedicht durch Fliegen und Gaslaternen veranschaulicht. Die Fliegen dienen der Spinne als Nahrung, das heißt die Reichen können ohne die ärmeren Arbeiter nicht existieren. Der Mond alleine gibt zu wenig Licht, deshalb gibt es die Laternen, aber auf keinen Fall dürfen diese zuviel Licht geben, sonst wird der Mond in seiner höheren Stellung beeinträchtigt. In der gesamten zweiten Strophe wird also die Stellung der Menschen in der Gesellschaft veranschaulicht. In Strophe III nun verengt sich die Perspektive auf „wir“, womit wahrscheinlich Menschen aus den sozial schwächeren Klassen gemeint sind. Diese Menschen wissen, dass sie mit ihren der Gesellschaft gegenüber hasserfüllten Ansichten dem Tode bzw. dem Untergang geweiht sind („Wir aber, die, verrucht, zum Tode taugen, / (!) Zerschreiten knirschend diese wüste Pracht“ (II,,1 und 2). Sie gehen durch die Welt mit ihrer Gesellschaftsordnung und ärgern sich („Knirschend“ heißt hier „Zähne knirschend“), dass diese für sie fürchterliche Ordnung so gut funktioniert („wüste Pracht“). Die letzten beiden Verse lauten: „Und stechen stumm die weißen Elendsaugen / Wie Spieße in die aufgeschwollne Nacht“ (III, 3/4). Diese Menschen bleiben stumm trotz ihrer Wut, wobei die Wut noch einmal durch die weißen Augen verdeutlicht wird, denn Tiere zeigen z.B. oft das Weiße in den Augen, wenn sie gereizt sind. Die „Elendsaugen“ sind ein weiterer Hinweis auf den sozialen Status der Personen, die diese nun wie Spieße in die vom Nebel aufgeschwollene Nacht stechen. Sie bleiben stumm, würden aber trotzdem gerne den Nebel verdrängen, also die sozial Starken vernichten, und gleichzeitig suchen sie mit den stechenden Blicken einen Weg aus dem Nebel, aus der Gesellschaft. Die Strophen I und II machen also jeweils im dritten und vierten Vers eine Hoffnung auf einen Weg aus der Gesellschaft zunichte. In Strophe III wird dann aber der nicht gebrochene Widerstand einiger Personen verdeutlicht, wobei aber auf die in den Strophen I und II angesprochenen Probleme zurückgegriffen wird.
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Interpretationshypothese bestätigt wurde.
Janina Diekmann© GBE 2001 Jg 12 (H.Abram)
|
|
|
|