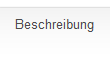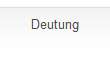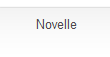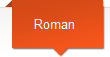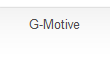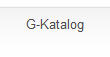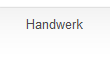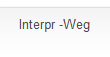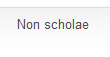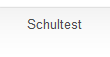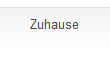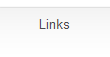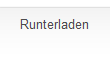|
|
|
|
|
Romantypologie - Romantyp Entwicklung ( Ich - und ) Er - Erzähler im Roman
Autobiographie Goethe: Dichtung und Wahrheit Grillparzer: Autobiographie Bildungsroman (s. Entwicklungsroman) Biographie Wassermann: Caspar Hauser (s. a. Fallbericht, Kriminalroman) Erziehungsroman Wieland: Don Sylvio (Satire) Entwicklungsroman Keller: Der Grüne Heinrich. 1. Fg Jugendroman: s. Kinder- und Jugendportal www.goethe.de (Goethe-Institut) Künstlerroman Wackenroder: Hans Sachs Tieck: Franz Sternbalds Wanderungen Psychologischer Roman: Moritz: Anton Reiser Goethe: Die Leiden des jungen Werther(s) (s. a. Ich-Erzähler) Zweig: Ungeduld des Herzens (Ich-Erzähler) *** Autobiographie
Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832) Dichtung und Wahrheit (1811/14) O mh dareis anrpos ou paideuetei Der nicht traktierte Mensch bleibt unerzogen.
ERSTES BUCH Am 28. August 1749, mittags mit dem Glockenschlage zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war glücklich: die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag; Jupiter und Venus blickten sie freundlich an, Merkur nicht widerwärtig, Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig; nur der Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins umso mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Erwidersetzte sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als bis diese Stunde vorübergegangen. Diese guten Aspekten, welche mir die Astrologen in der Folgezeit sehr hoch anzurechnen wussten, mögen wohl Ursache an meiner Erhaltung gewesen sein: denn durch Ungeschicklichkeit der Hebamme kam ich für tot auf die Welt, und nur durch vielfache Bemühungen brachte man es dahin, dass ich das Licht erblickte. Dieser Umstand, welcher die Meinigen in große Not versetzt hatte, gereichte jedoch meinen Mitbürgern zum Vorteil, indem mein Großvater, der Schultheiß Johann Wolfgang Textor, daher Anlass nahm, dass ein Geburtshelfer angestellt und der Hebammenunterricht eingeführt oder erneuert wurde; welches denn manchem der Nachgebornen mag zugute gekommen sein. Wenn man sich erinnern will, was uns in der frühsten Zeit der Jugend begegnet ist, so kommt man oft in den Fall, dasjenige, was wir von ändern gehört, mit dem zu verwechseln, was wir wirklich aus eigner anschauender Erfahrung besitzen. Ohne also hierüber eine genaue Untersuchung anzustellen, welche ohnehin zu nichts führen kann, bin ich mir bewusst, dass wir in einem alten Hause wohnten, welches eigentlich aus zwei durchgebrochenen Häusern bestand. Eine turmartige Treppe führte zu unzusammenhangenden Zimmern, und die Ungleichheit der Stockwerke war durch Stufen ausgeglichen. Für uns Kinder, eine jüngere Schwester und mich, war die untere weitläufige Hausflur der liebste Raum, welche neben der Türe ein großes hölzernes Gitterwerk hatte, wodurch man unmittelbar mit der Straße und der freien Luft in Verbindung kam. Einen solchen Vogelbauer, mit dem viele Häuser versehen waren, nannte man ein Geräms. Die Frauen saßen darin, um zu nähen und zu stricken; die Köchin las ihren Salat; die Nachbarinnen besprachen sich von daher miteinander, und die Straßen gewannen dadurch in der guten Jahrszeit ein südliches Ansehen. Man fühlte sich frei, indem man mit dem öffentlichen vertraut war. So kamen auch durch diese Gerämse die Kinder mit den Nachbarn in Verbindung, und mich gewannen drei gegenüber wohnende Brüder von Ochsenstein, hinterlassene Söhne des verstorbenen Schultheißen, gar lieb und beschäftigten und neckten sich mit mir auf mancherlei Weise. Die Meinigen erzählten gern allerlei Eulenspiegeleien, zu denen mich jene sonst ernsten und einsamen Männer angereizt. Ich führe nur einen von diesen Streichen an. Es war eben Topfmarkt gewesen, und man hatte nicht allein die Küche für die nächste Zeit mit solchen Waren versorgt, sondern auch uns Kindern dergleichen Geschirr im kleinen zu spielender Beschäftigung eingekauft. An einem schönen Nachmittag, da alles ruhig im Hause war, trieb ich im Geräms mit meinen Schüsseln und Töpfen mein Wesen, und da weiter nichts dabei herauskommen wollte, warf ich ein Geschirr auf die Straße und freute mich, dass es so lustig zerbrach. Die von Ochsenstein, welche sahen, wie ich mich daran ergetzte, dass ich sogar fröhlich in die Händchen patschte, riefen: „Noch mehr!" Ich säumte nicht, sogleich einen Topf, und auf immer fortwährendes Rufen: „Noch mehr!" nach und nach sämtliche Schüsselchen, Tiegelchen, Kännchen gegen das Pflaster zu schleudern. Meine Nachbarn fuhren fort, ihren Beifall zu bezeigen, und ich war höchlich froh, ihnen Vergnügen zu machen. Mein Vorrat aber war aufgezehrt, und sie riefen immer: „Noch mehr!" Ich eilte daher stracks in die Küche und holte die irdenen Teller, welche nun freilich im Zerbrechen noch ein lustigeres Schauspiel gaben; und so lief ich hin und wider, brachte einen Teller nach dem ändern, wie ich sie auf dem Topfbrett der Reihe nach erreichen konnte, und weil sich jene gar nicht zufrieden gaben, so stürzte ich alles, was ich von Geschirr erschleppen konnte, in gleiches Verderben. Nur später erschien jemand, zu hindern und zu wehren. Das Unglück war geschehen, und man hatte für so viel zerbrochne Töpferware wenigstens eine lustige Geschichte, an der sich besonders die schalkischen Urheber bis an ihr Lebensende ergetzten. Meines Vaters Mutter, bei der wir eigentlich im Hause wohnten, lebte in einem großen Zimmer hinten hinaus, unmittelbar an der Hausflur, und wir pflegten unsere Spiele bis an ihren Sessel, ja wenn sie krank war, bis an ihr Bett hin auszudehnen. Ich erinnere mich ihrer gleichsam als eines Geistes, als einer schönen, hagern, immer weiß und reinlich gekleideten Frau. Sanft, freundlich, wohlwollend ist sie mir im Gedächtnis geblieben. Wir hatten die Straße, in welcher unser Haus lag, den Hirschgraben nennen hören; da wir aber weder Graben noch Hirsche sahen, so wollten wir diesen Ausdruck erklärt wissen. Man erzählte sodann, unser Haus stehe auf einem Raum, der sonst außerhalb der Stadt gelegen, und da, wo jetzt die Straße sich befinde, sei ehmals ein Graben gewesen, in welchem eine Anzahl Hirsche unterhalten worden. Man habe diese Tiere hier bewahrt und genährt, weil nach einem alten Herkommen der Senat alle Jahre einen Hirsch öffentlich verspeiset, den man denn für einen solchen Festtag hier im Graben immer zur Hand gehabt, wenn auch auswärts Fürsten und Ritter der Stadt ihre Jagdbefugnis verkümmerten und störten oder wohl gar Feinde die Stadt eingeschlossen oder belagert hielten. Dies gefiel uns sehr, und wir wünschten, eine solche zahme Wildbahn wäre auch noch bei unsern Zeiten zu sehen gewesen. Die Hinterseite des Hauses hatte, besonders aus dem oberen Stock, eine sehr angenehme Aussicht über eine beinah unabsehbare Fläche von Nachbarsgärten, die sich bis an die Stadtmauern verbreiteten. Leider aber war bei Verwandlung der sonst hier befindlichen Gemeindeplätze in Hausgärten unser Haus und noch einige andere, die gegen die Straßenecke zu lagen, sehr verkürzt worden, indem die Häuser vom Rossmarkt her weitläufige Hintergebäude und große Gärten sich zueigneten, wir aber uns durch eine ziemlich hohe Mauer unseres Hofes von diesen so nah gelegenen Paradiesen ausgeschlossen sahen. Im zweiten Stock befand sich ein Zimmer, welches man das Gartenzimmer nannte, weil man sich daselbst durch wenige Gewächse vor dem Fenster den Mangel eines Gartens zu ersetzen gesucht hatte. Dort war, wie ich heranwuchs, mein liebster, zwar nicht trauriger, aber doch sehnsüchtiger Aufenthalt. Über jene Gärten hinaus, über Stadtmauern und Wälle sah man in eine schöne, fruchtbare Ebene; es ist die, welche sich nach Höchst hinzieht. Dort lernte ich Sommerszeit gewöhnlich meine Lektionen, wartete die Gewitter ab und konnte mich an der untergehenden Sonne, gegen welche die Fenster gerade gerichtet waren, nicht satt genug sehen. Da ich aber zu gleicher Zeit die Nachbarn in ihren Gärten wandeln und ihre Blumen besorgen, die Kinder spielen, die Gesellschaften sich ergetzen sah, die Kegelkugeln rollen und die Kegel fallen hörte, so erregte dies frühzeitig in mir ein Gefühl der Einsamkeit und einer daraus entspringenden Sehnsucht, das, dem von der Natur in mich gelegten Ernsten und Ahnungsvollen entsprechend, seinen Einfluss gar bald und in der Folge noch deutlicher zeigte. Die alte, winkelhafte, an vielen Stellen düstere Beschaffenheit des Hauses war übrigens geeignet, Schauer und Furcht in kindlichen Gemütern zu erwecken. Unglücklicherweise hatte man noch die Erziehungsmaxime, den Kindern frühzeitig alle Furcht vor dem Ahnungsvollen und Unsichtbaren zu benehmen und sie an das Schauderhafte zu gewöhnen. Wir Kinder sollten daher allein schlafen, und wenn uns dieses unmöglich fiel und wir uns sacht aus den Betten hervormachten und die Gesellschaft der Bedienten und Mägde suchten, so stellte sich, in umgewandtem Schlafrock und also für uns verkleidet genug, der Vater in den Weg und schreckte uns in unsere Ruhestätte zurück. Die daraus entspringende üble Wirkung denkt sich jedermann. Wie soll derjenige die Furcht loswerden, den man zwischen ein doppeltes Furchtbare einklemmt? Meine Mutter, stets heiter und froh und ändern das gleiche gönnend, erfand eine bessere pädagogische Auskunft. Sie wusste ihren Zweck durch Belohnungen zu erreichen. Es war die Zeit der Pfirschen, deren reichlichen Genus sie uns jeden Morgen versprach, wenn wir nachts die Furcht überwunden hätten. Es gelang, und beide Teile waren zufrieden. Innerhalb des Hauses zog meinen Blick am meisten eine Reihe römischer Prospekte auf sich, mit welchen der Vater einen Vorsaal ausgeschmückt hatte, gestochen von einigen geschickten Vorgängern des Piranese, die sich auf Architektur und Perspektive wohl verstanden und deren Nadel sehr deutlich und schätzbar ist. Hier sah ich täglich die Piazza del Popolo, das Coliseo, den Petersplatz, die Peterskirche von außen und innen, die Engelsburg und so manches andere. Diese Gestalten drückten sich tief bei mir ein, und der sonst sehr lakonische Vater hatte wohl manchmal die Gefälligkeit, eine Beschreibung des Gegenstandes vernehmen zu lassen. Seine Vorliebe für die italienische Sprache und für alles, was sich auf jenes Land bezieht, war sehr ausgesprochen. Eine kleine Marmor- und Naturaliensammlung, die er von dorther mitgebracht, zeigte er uns auch manchmal vor, und einen großen Teil seiner Zeit verwendete er auf seine italienisch verfasste Reisebeschreibung, deren Abschrift und Redaktion er eigenhändig, heftweise, langsam und genau ausfertigte. Ein alter, heiterer italienischer Sprachmeister, Giovinazzi genannt, war ihm daran behülflich. Auch sang der Alte nicht übel, und meine Mutter musste sich bequemen, ihn und sich selbst mit dem Klaviere täglich zu akkompagnieren; da ich denn das ,Solitario bosco ombroso' bald kennen lernte, und auswendig wusste, ehe ich es verstand. Schäften wollte er gern dasjenige, was er wusste und vermochte, auf andere übertragen. So hatte er meine Mutter in den ersten Jahren ihrer Verheiratung zum fleißigen Schreiben angehalten wie zum Klavierspielen und Singen; wobei sie sich genötigt sah, auch in der italienischen Sprache einige Kenntnis und notdürftige Fertigkeit zu erwerben. Gewöhnlich hielten wir uns in allen unsern Freistunden zur Großmutter, in deren geräumigem Wohnzimmer wir hinlänglich Platz zu unsern Spielen fanden. Sie wusste uns mit allerlei Kleinigkeiten zu beschäftigen und mit allerlei guten Bissen zu erquicken. An einem Weihnachtsabende jedoch setzte sie allen ihren Wohltaten die Krone auf, indem sie uns ein Puppenspiel vorstellen ließ und so in dem alten Hause eine neue Welt erschuf. Dieses unerwartete Schauspiel zog die jungen Gemüter mit Gewalt an sich; besonders auf den Knaben machte es einen sehr starken Eindruck, der in eine große, langdauernde Wirkung nachklang. *
Grillparzer (1791 – 1872) Fragmente einer Selbstbiographie (1.) - Er-Erzähler [1834-1835] Franz Grillparzer geboren zu Wien am 15. Jänner 1791. Sein Vater war Advokat und der Sohn ward, als der älteste von vier Brüdern zu demselben Stande bestimmt. Die hypochondrische Zurückgezogenheit des Vaters bestimmte auch die Lebensart des Sohnes, der beinahe ohne Umgang mit seinen Altersgenossen und durch Neigungsver-schiedenheiten von seinen Brüdern entfernt gehalten, die erste Jugend in fast völ- liger Einsamkeit zubrachte. Früh zum Lernen angehalten, las er mit vier Jahren bereits geläufig und gab sich von da an einem schrankenlosen Hang zur Lektüre hin, die äußerer Abhaltungsmittel bedurfte um nicht geradezu zerstörend zu werden. Die Neigung zur Poesie zeigte sich in dieser Periode bei ihm Biehr nach innen durch phantastisches Brüten, als daß er sich m Darstellung nach Außen angetrieben gefühlt hätte. Die ersten Aufsätze die er schrieb waren in poetischer Prosa; ja seine Lehrer hatten ihm schon alles Ohr für die Metrik abgesprochen, als ihn eine helle Mondnacht zu einem Gedichte auf den Mond begeisterte, das so sehr seine Fähigkeiten zu übersteigen schien, daß es den Zorn des Lehrers erweckte, der durchaus ein Geständnis erpressen wollte, wer der eigentliche Verfasser der gelungenen Verse sei. Einige darauf gefolgte andere lyrische Gedichte trugen zur Entwicklung nichts Entscheidendes bei. Ostreich war damals von dem literarischen Verkehre Deutschlands so abgeschieden, dass Grillparzer erst in seinem achtzehnten Jahre Goethes Werke kennen gelernt hat. In seinem fünfzehnten Jahre begann er ein Trauerspiel: Blanka von Kastilien, das aus der Geschichte Peter des Grausamen genommen, von ungeheurer Ausdehnung, und so ziemlich Schillern nachgeahmt war. Als im Jahre 1809 sein Vater starb und er dadurch in große Not versetzt wurde, erinnerte G[rillparzer] sich dieses Trauerspieles »jeder und übergab es, geradezu aus Not, dem Wiener Hoftheater. Es wurde ihm, als nicht zur Aufführung geeignet, zurückgestellt. Diese Zurückweisung machte auf ihn, der ohnehin von Natur einen Widerwillen gegen jedes öffentliche Auftreten hatte, einen tiefen Eindruck. Er erinnerte sich der Vorhersagungen seines Vaters, der ihn immer vor der Poesie gewarnt hatte, und, zu stolz sich mit einem untergeordneten Platze zu begnügen, beschloß er der Dichtkunst zu entsagen. Er trat als Hofmeister in ein vornehmes Haus, wo die widerlichsten Verhältnisse seine ganze Jugend zerstörten und er, so oft Rückfälle zur Poesie ihm ein Gedicht abnötigten, sich gezwungen sah dem Manuskript die Anmerkung: aus dem Französischen oder dem Englischen übersetzt, beizufügen, um ja, wenn das Gedicht gefunden würde, nicht für einen Dichter gehalten zu werden. Später trat er als Praktikant bei der kaiserlichen Hofbibliothek in Wien ein. Da aber die Aussichten daselbst ihm, der für seine ganz verarmte Mutter zu sorgen hatte, zu entfernt schienen, so sah er sich genötigt eine Stelle beim Zollwesen zu suchen und anzunehmen, wo ein einflußreicher Gönner ihm eine baldige Beförderung zusagte. Die eingeschlummerte Neigung zur dramatischen Poesie war mittlerweile durch das Bekanntwerden mit der spanischen Literatur wieder geweckt worden. Ohne Unter-weisung, nur mit Hilfe einer im siebzehnten Jahrhundert zu Augsburg gedruckten elenden spanischen Grammatik und eines mangelhaften Exemplars von Sobrinos Wörterbuche aus derselben Zeit, hatte er sich unmittelbar an Calderons Komödien gemacht und frischweg angefangen sie in deutsche Reime zu übersetzen. Der Plan zur Ahnfrau entstand in ihm während dieser Arbeit. Nach seiner gewöhnlichen innerlichen Art aber, und seinen Vorsätzen getreu, dachte er aber nicht an die Ausführung. Da machte ihn der Zufall mit dem Theatersekretär Schreyvogel bekannt, dem er den Plan erzählte, und der ihn aufs dringendste zur Handanlegung aufforderte. G[rillparzerJ hatte wenig Lust dazu. Endlich aber schrieb er einmal abends vor dem Schlafengehen halb wider Willen die ersten Verse nieder, und in drei Wochen war das Stück fertig, das die ungeheuerste Wirkung auf allen deutschen Bühnen machte, die Lage des Verfassers aber nicht wesentlich verbesserte, da es ihm an Theater- und Buchhändler-Honorar kaum 100 Dukaten eintrug. Indem die albernste und mitunter boshafteste Kritik ihm die Freude an diesem Gelingen nur zu sehr verbitterte, trieb der Ekel vor den dabei zu Tage gebrachten Ideen ihn bei seiner zweiten Arbeit auf einen dem frühern geradezu entgegengesetzten Stoff. Er sehrieb ein Jahr darauf [1818] sein Trauerspiel Sappho, das, womöglich noch größeren Beifall erhielt und von der Gilde nicht weniger verketzert wurde. Durch eine Eigenheit seiner Natur zur Lösung von Schwierigkeiten getrieben, führte ihn ein ungünstiges Geschick auf den Stoff seiner dritten dramatischen Arbeit, die unter dem Titel: das goldene Vließ, die Geschichte der Medea, von der Ankunft des Phryxus zum Kindermorde in drei Tragödien behandelte. Ich sage ein ungünstiges Geschick, weil bei der Unmöglichkeit die ungeheure Aufgabe genügend zu lösen, die übelste Wirkung auf die Gemütsstimmung des Verfassers zu befürchten war. Bereits gegen den Schluß des zweiten Teiles der Trilogie, die Argonauten, vorgerückt, starb nach einer kurzen Krankheit Grillparzers Mutter, die er innigst geliebt, und die gleichsam der Schutzengel seines Lebens gewesen war. Unfähig zu arbeiten, ja zu leben, trat er eine Reise nach Italien an, die seine Gesundheit zwar wieder herstellte, zugleich aber den Grund zu all den Unannehmlichkeiten legte, die ihn in der Folge in so vollem Maße überschütteten. Er schrieb nämlich an Ort und Stelle nebst mehreren ändern lyrischen Gedichten auch eines auf die Ruinen des Campo vaccino in Rom, wo denn nun freilich in Vergleich mit dem Altertume die neue Zeit nicht sehr gut wegkam.
1853 – 1854 folgte diesem Versuch in Er-Perspektive ein erheblich umfangreichere Selbstbiographie (rund 140 Seiten), formal mit einem Ich-Erzähler angelegt:
SELBSTBIOGRAPHIE (3.) - Ich-Erzähler [1853-1854] Die Akademie fordert mich [nunmehr zum drittenmale] auf, ihr meine Lebensumstände zum Behufe ihres Almanachs mitzuteilen. Ich -will es versuchen, nur fürchte ich, wenn sich das Interesse daran einstellen sollte, zu weitläufig zu werden. Man kann ja aber später auch abkürzen. Ich bin zu Wien am 15. Jänner 1791 geboren. Mein Vater war Advokat, ein streng rechtlicher, in sich gezogener Mann. Da seine Geschäfte und seine natürliche Verschlossenheit ihm nicht erlaubte sich mit seinen Kindern viel abzugeben, er auch starb, ehe ich volle achtzehn Jahre alt war, und in den letzten Jahren seines Lebens Krankheit, die grässlichen Kriegsjahre und der durch beides herbeigeführte Verfall seiner häuslichen Umstände, jene Verschlossenheit nur vermehrten, so kann ich von dem Innern seines Wesens mir und ändern keine Rechenschaft geben. Sein äußres Benehmen hatte etwas Kaltes und Schroffes, er vermied jede Gesellschaft, war aber ein leidenschaftlicher Freund der Natur. Früher einen eigenen, später einen gemieteten Garten selbst zu bearbeiten und Blumen aller Art zu ziehen, machte beinahe seine einzige Erheiterung aus. Nur auf Spaziergängen, bei denen er, auf unglaubliche Entfernungen, manchmal die ganze Familie, häufig aber auch nur mich, noch als Kind, mitnahm, wurde er froh und mitteilsam. Wenn ich mich erinnere, dass es ihm, bei solchen Spaziergängen am Ufer der Donau, Vergnügen machte, den Inseln im Flusse, nach Art der Weltumsegler, selbstgewählte Namen zu geben, so muss ich glauben, dass in früherer Zeit die Regungen der Phantasie ihm nicht fremd gewesen sein müssen, ja noch später, in den Jahren meiner Lesewut, konnte ich ihm kein größeres Vergnügen machen, als wenn ich ihm Romane, aber ausschließlich Ritter- und Geistergeschichten zutrug, die dann der ernste Mann, am schwedischen Ofen stehend und ein Glas Bier dazu trinkend, bis in die späte Nacht hinein las. Neuere Geschichten waren ihm wegen ihres Konventionellen zuwider. Meine Mutter war eine herzensgute Frau, plagte sich mit ihren Kindern, suchte Ordnung herzustellen, die sie, die Wahrheit zu sagen, selbst nicht gar genau hielt und lebte und webte in der Musik, die sie mit Leidenschaft liebte und trieb. Ich war der älteste von drei Brüdern, zu denen erst spät, als ich schon ziemlich erwachsen war, ein vierter hinzukam. Man hielt mich für den Liebling meines Vaters, obwohl er mir nie ein Zeichen davon gab. Im Gegenteile unterhielt er sich am liebsten mit dem Dritten, der ihn, von Geschäften ermüdet, durch unschädliche Wunderlichkeiten in seinem Entwicklungsgang erheiterte. Der Zweite war ihm durch sein trotziges und störrisches Wesen beinahe zuwider. Oberhaupt kann man sich verschiedenere Charaktere als diese drei Brüder nicht denken. Von dem zweiten ist schon die Rede gewesen. Der dritte war ein bildschöner Knabe und dadurch von den Weibern verhätschelt. Da nun zugleich meine Mutter, wenn der Lärm zu arg wurde, kein Mittel wusste, als die Schuldigen zu sich zu rufen und, in Form von Strafe, zu verhalten, an einem „Strumpfband" zu stricken, so hatte der Jüngste die Sache ernsthaft genommen und strickte und stickte wie ein Mädchen. Er hatte sich drei Ecken des Zimmers mit gedachten und auch benannten Frauen bevölkert, denen er wechselweise Besuche abstattete. Mein Vater abends im Zimmer auf und niedergehend, versuchte ihm auch für die vierte Ecke eine vierte Frau aufzudringen, die aber, da der vorgeschlagene Name den Spott gar zu deutlich an sich trug, der Knabe durchaus nicht akzeptierte. Durch diese Grundverschiedenheit von meinen Brüdern entfernt gehalten, und da unser Vater zugleich sich von jeder Bekanntschaft abschloss, wuchs ich in völliger Vereinzelung heran. Um das Formlose und Trübe meiner ersten Jahre begreiflich zu machen, muss ich sogar unsere Wohnung beschreiben. (…) * Bildungsroman ( s. Entwicklungsroman)
Christoph M. Wieland: Die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre Gottfried Keller: Der grüne Heinrich (1. Fg. Er-Erzähler) Thomas Mann: Felix Krull (s.a. Schelmenroman) Peter Handke: Der kurze Brief vom langen Abschied (1972) (kein Copyright)
Handke stellt seiner Ich-Erzählung ein Zitat aus Moritz’ „Anton Reiser“ voran: „Und einst, da sie an einem warmen, aber trüben Morgen vors Tor hinausgingen, sagte Iffland, dies wäre gutes Wetter, davonzugehen – und das Wetter schien auch so reisemäßig, der Himmel so dicht auf der Erde liegend, die Gegenstände umher so dunkel, gleichsam als sollte die Aufmerksamkeit nur auf die Straße, die man wandern wollte, hingeheftet werden.”
Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832) Wilhelm Meister (1821/ 29) Erstes Buch – Erstes Kapitel Das Schauspiel dauerte sehr lange. Die alte Barbara trat einigemal ans Fenster und horchte, ob die Kutschen nicht rasseln wollten. Sie erwartete Marianen, ihre schöne Gebieterin, die heute im Nachspiele als junger Offizier gekleidet das Publikum entzückte, mit größerer Ungeduld als sonst, wenn sie ihr nur ein mäßiges Abendessen vorzusetzen hatte; diesmal sollte sie mit einem Paket überrascht werden, das Norberg, ein junger, reicher Kaufmann, mit der Post geschickt hatte, um zu zeigen, dass er auch in der Entfernung seiner Geliebten gedenke. Barbara war als alte Dienerin, Vertraute, Ratgeberin, Unterhändlerin und Haushälterin im Besitz des Rechtes, die Siegel zu eröffnen, und auch diesen Abend konnte sie ihrer Neugierde um so weniger widerstehen, als ihr die Gunst des freigebigen Liebhabers sehr als selbst Marianen am Herzen lag. Zu ihrer größten Freude hatte sie in dem Paket ein feines Stück Nesseltuch und die neuesten Bänder für Marianen, für sich aber ein Stück Kattun, Halstücher und ein Röllchen Geld gefunden. Mit welcher Neigung, welcher Dankbarkeit erinnerte sie sich des abwesenden Norbergs! wie lebhaft nahm sie sich vor, auch bei Marianen seiner im besten zu gedenken, sie zu erinnern, was sie ihm schuldig sei und was er von ihrer Treue hoffen und erwarten müsse. Das Nesseltuch, durch die Farbe der halbaufgerollten Bänder belebt, lag wie ein Christgeschenk auf dem Tischchen; die Stellung der Lichter erhöhte den Glanz der Gabe, alles war in Ordnung, als die Alte den Tritt Marianens auf der Treppe vernahm und ihr entgegen eilte. Aber wie sehr verwundert trat sie zurück, als das weibliche Offizierchen, ohne auf die Liebkosungen zu achten, sich an ihr vorbeidrängte, mit ungewöhnlicher Hast und Bewegung in das Zimmer trat. Federhut und Degen auf den Tisch warf, unruhig auf und nieder ging und den feierlich angezündeten Lichtern keinen Blick gönnte. „Was hast du, Liebchen?" rief die Alte verwundert aus. „Ums Himmels willen, Töchterchen, was gibts? Sieh hier diese Geschenke! Von wem können sie sein, als von deinem zärtlichsten Freunde? Norberg schickt dir das Stück Musselin zum Nachtkleide, bald ist er selbst da; er scheint mir eifriger und freigebiger als jemals." Die Alte kehrte sich um und wollte die Gaben, womit er auch sie bedacht, vorweisen, als Mariane, sich von den Geschenken wegwendend, mit Leidenschaft ausrief: „Fort, fort! heute will ich nichts von allem diesen hören; ich habe dir gehorcht, du hast es gewollt, es sei so! Wenn Norberg zurückkehrt, bin ich wieder sein, bin ich dein, mache mit mir, was du willst; aber bis dahin will ich mein sein, und hättest du tausend Zungen, du solltest mir meinen Vorsatz nicht ausreden. Dieses ganze Mein will ich dem geben, der mich liebt und den ich hebe. Keine Gesichter! Ich will mich dieser Leidenschaft überlassen, als wenn sie ewig dauern sollte." Der Alten fehlte es nicht an Gegenvorstellungen und Gründen; doch da sie in fernerem Wortwechsel heftig und bitter ward, sprang Mariane auf sie los und fasste sie bei der Brust. Die Alte lachte überlaut. „Ich werde sorgen müssen", rief sie aus, „dass sie wieder bald in lange Kleider kommt, wenn ich meines Lebens sicher sein will. Fort, zieht Euch aus! Ich hoffe, das Mädchen wird mir abbitten, was ,ir der flüchtige Junker Leids zugefügt hat; herunter mit dem Rock und immer so fort alles herunter! es ist eine unbequeme Tracht, und für Euch gefährlich, wie ich merke. Die Achselbänder begeistern Euch." Die Alte hatte Hand an sie gelegt, Mariane riss sich los. „Nicht so geschwind!" rief sie aus, „ich habe noch heute Besuch zu erwarten." „Das ist nicht gut", versetzte die Alte. „Doch nicht den jungen, zärtlichen, unbefiederten Kaufmannssohn?" - „Eben den", versetzte Mariane. „Es scheint, als wenn die Großmut Eure herrschende Leidenschaft werden wollte", erwiderte die Alte spottend; „Ihr nehmt Euch der Unmündigen, der Unvermögenden mit großem Eifer an. Es muss reizend sein, als uneigennützige Geberin angebetet zu werden." „Spotte, wie du willst. Ich lieb ihn! Ich lieb ihn! Mit welchem Entzücken sprech ich zum erstenmal diese Worte aus! Das ist diese Leidenschaft, die ich so oft vorgestellt habe, von der ich keinen Begriff hatte. Ja, ich will mich ihm um den Hals werfen! ich will ihn fassen, als wenn ich ihn ewig halten wollte. Ich will ihm meine ganze Liebe zeigen, seine Liebe in ihrem ganzen Umfang genießen." „Mäßigt Euch", sagte die Alte gelassen, „mäßigt Euch! Ich muss Eure Freude durch ein Wort unterbrechen: Norberg kommt! in vierzehn Tagen kommt er! Hier ist sein Brief, der die Geschenke begleitet hat." „Und wenn mir die Morgensonne meinen Freund rauben sollte, will ich mirs verbergen. Vierzehn Tage! Welche Ewigkeit! In vierzehn Tagen, was kann da nicht vorfallen, was kann sich da nicht verändern!" Wilhelm trat herein. Mit welcher Lebhaftigkeit flog sie ihm entgegen! mit welchem Entzücken umschlang er die rote Uniform, drückte er das weiße Atlaswestchen an seine Brust! Wer wagte hier zu beschreiben, wem geziemt es, die Seligkeit zweier Liebenden auszusprechen! Die Alte ging murrend beiseite, wir entfernen uns mit ihr und lassen die Glücklichen allein. Zweites Kapitel Als Wilhelm seine Mutter des ändern Morgens begrüßte, eröffnete sie ihm, dass der Vater sehr verdrießlich sei und ihm den täglichen Besuch des Schauspiels nächstens untersagen werde. „Wenn ich gleich selbst", fuhr sie fort, „manchmal gern ins Theater gehe, so möchte ich es doch oft verwünschen, da meine häusliche Ruhe durch deine unmäßige Leidenschaft zu diesem Vergnügen gestört wird. Der Vater wiederholt immer, wozu es nur nütze sei? Wie man seine Zeit nur so verderben könne?" „Ich habe es auch schon von ihm hören müssen", versetzte Wilhelm, „und habe ihm vielleicht zu hastig geantwortet aber ums Himmels willen, Mutter! ist denn alles unnütz, was uns nicht unmittelbar Geld in den Beutel bringt, was uns nicht den allernächsten Besitz verschafft? Hatten wir in dem alten Hause nicht Raum genug? und war es nötig, ein neues zu bauen? Verwendet der Vater nicht jährlich einen ansehnlichen Teil seines Handelsgewinnes zur Verschönerung der Zimmer? Diese seidenen Tapeten, diese englischen Mobilien, sind sie nicht auch unnütz? Könnten wir uns nicht mit geringeren begnügen? Wenigstens bekenne ich, dass mir diese gestreiften Wände, diese hundertmal wiederholten Blumen, Schnörkel, Körbchen und Figuren einen durchaus unangenehmen Eindruck machen. Sie kommen mir höchstens vor wie unser Theatervorhang. Aber wie anders ists, vor diesem zu sitzen! Wenn man noch so lange warten muss, so weiß man doch, er wird in die Höhe gehen, und wir werden die mannigfaltigsten Gegenstände sehen, die uns unterhalten, aufklären und erheben." „Mach es nur mäßig", sagte die Mutter, „der Vater will auch abends unterhalten sein; und dann glaubt er, es zerstreue dich, und am Ende trag ich, wenn er verdrießlich wird, die Schuld. Wie oft musste ich mir das verwünschte Puppenspiel vorwerfen lassen, das ich euch vor zwölf Jahren zum heiligen Christ gab und das euch zuerst Geschmack am Schauspiele beibrachte!" „Schelten Sie das Puppenspiel nicht, lassen Sie sich Ihre Liebe und Vorsorge nicht gereuen! Es waren die ersten vergnügten Augenblicke, die ich in dem neuen, leeren Hause genoss; ich sehe es diesen Augenblick noch vor mir, ich weiß, wie sonderbar es mir vorkam, als man uns nach Empfang der gewöhnlichen Christgeschenke vor einer Türe niedersitzen hieß, die aus einem ändern Zimmer hereinging. Sie eröffnete sich; allein nicht wie sonst zum Hin- und Widerlaufen, der Eingang war durch eine unerwartete Festlichkeit ausgefüllt. Es baute sich ein Portal in die Höhe, das von einem mystischen Vorhang verdeckt war. Erst standen wir alle von ferne, und wie unsere Neugierde größer ward, um zu sehen, was wohl Blinkendes und Rasselndes sich hinter der halb durchsichtigen Hülle verbergen möchte, wies man jedem sein Stühlchen an und gebot uns, in Geduld zu warten. (…) * Biographie (Fallbericht)
Jakob Wassermann ( 1873 - 1934) Caspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens (Dies ist die Geschichte des Findlings, den man im Jahre 1878 als 17jährigen vor den Toren Nürnbergs auffindet. Seine Herkunft ist unbekannt, und schon bald verdichten sich die Gerüchte um seine Person: man vermutet in ihm den legitimen Sproß eines Fürstenhauses, der beseitigt wurde, um einer Nebenlinie in der Erbfolge Platz zu machen. Der Name Caspar Hauser bleibt ihm.) In den ersten Sommertagen des Jahres 1828 liefen in Nürnberg sonderbare Gerüchte über einen Menschen, der im Vestnerturm auf der Burg in Gewahrsam gehalten wurde und der sowohl der Behörde wie den ihn beobachtenden Privatpersonen täglich mehr zu staunen gab. Es war ein Jüngling von ungefähr siebzehn Jahren. Niemand wußte, woher er kam. Er selbst vermochte keine Auskunft darüber zu erteilen, denn er war der Sprache nicht mächtiger als ein zweijähriges Kind; nur wenige Worte konnte er deutlich aussprechen, und diese wiederholte er immer wieder mit lallender Zunge, bald klagend, bald freudig, als wenn kein Sinn dahintersteckte und sie nur unverstandene Zeichen seiner Angst oder seiner Lust wären. Auch sein Gang glich dem eines Kindes, das gerade die ersten Schritte erlernt hat: nicht mit der Ferse berührte er zuerst den Boden, sondern trat schwerfällig und vorsichtig mit dem ganzen Fuße auf. Die Nürnberger sind ein neugieriges Volk. Jeden Tag wanderten Hunderte den Burgberg hinauf und erklommen die zweiundneunzig Stufen des finstern alten Turmes, um den Fremdling zu sehen. In die halbverdunkelte Kammer zu treten, wo der Gefangene weilte, war untersagt, und so erblickten ihre dicht gedrängten Scharen von der Schwelle aus das wunderliche Menschenwesen, das in der entferntesten Ecke des Raumes kauerte und meist mit einem kleinen weißen Holzpferdchen spielte, das es zufällig bei den Kindern des Wärters gesehen und das man ihm, gerührt von dein unbeholfenen Stammeln seines Verlangens, geschenkt hatte. Seine Augen schienen das Licht nicht erfassen zu können; er hatte offenbar Furcht vor der Bewegung seines eignen Körpers, und wenn er seine Hände zum Tasten erhob, war es, als ob ihm die Luft dabei einen rätselhaften Widerstand entgegensetzte. Welch ein armseliges Ding, sagten die Leute; viele waren der Ansicht, daß man eine neue Spezies entdeckt habe, eine Art Höhlenmensch etwa, und unter den berichteten Seltsamkeiten war nicht die geringste die, daß der Knabe jede andre Nahrung als Wasser und Brot mit Abscheu zurückwies. Nach und nach wurden die einzelnen Umstände, unter denen der Fremdling aufgetaucht war, allgemein bekannt. Am Pfingstmontag gegen die fünfte Nachmittagsstunde war er plötzlich auf dem Unschlittplatz, unweit vom Neuen Tor, gestanden, hatte eine Weile verstört um sich geschaut und war dann dem zufällig des Weges kommenden Schuster Weikmann geradezu in die Arme getaumelt. Seine bebenden Finger wiesen einen Brief mit der Adresse des Rittmeisters Wessenig vor, und da nun einige andre Personen hinzukamen, schleppte man ihn mit ziemlicher Mühe bis zum Haus des Rittmeisters. Dort fiel er erschöpft auf die Stufen, und durch die zerrissenen Stiefel sickerte Blut. Der Rittmeister kam erst um die Dämmerungsstunde heim, und seine Frau erzählte ihm, daß ein verhungerter und halbvertierter Bursche auf der Streu im Stall schlafe; zugleich übergab sie ihm den Brief, den der Rittmeister, nachdem er das Siegel erbrochen, mit größter Verwunderung einige Male durchlas; es war ein Schriftstück, ebenso humoristisch in einigen Punkten wie in andern von grausamer Deutlichkeit. Der Rittmeister begab sich in den Stall und ließ den Fremdling aufwecken, was mit vieler Anstrengung zustande gebracht wurde. Die militärisch gemessenen Fragen des Offiziers wurden von dem Knaben nicht oder nur mit sinnlosen Lauten beantwortet, und Herr von Wessenig entschied sich kurzerhand, den Zuläufer auf die Polizeiwachtstube bringen zu lassen. Auch dieses Unternehmen war mit Schwierigkeiten verknüpft, denn der Fremdling konnte kaum mehr gehen; Blutspuren bezeichneten seinen Weg; wie ein störrisches Kalb mußte er durch die Straßen gezogen werden, und die von den Feiertagsausflügen heimkehrenden Bürger hatten ihren Spaß an der Sache. »Was gibts denn?« fragten die, welche den ungewohnten Tumult nur aus der Ferne beobachteten. »Ei, sie führen einen betrunkenen Bauern«, lautete der Bescheid. Auf der Wachtstube bemühte sich der Aktuar umsonst, mit dem Häftling ein Verhör anzustellen; er lallte immer wieder dieselben halb blödsinnigen Worte vor sich hin, und Schimpfen und Drohen nutzte nichts. Als einer der Soldaten Licht anzündete geschah etwas Sonderbares. Der Knabe machte mit dem Oberkörper tanzbärenhaft hüpfende Bewegungen und griff mit den Händen in die, Kerzenflamme; aber als er dann die Brandwunde verspürte, fing er so zu weinen an, daß es allen durch Mark und Bein ging. Endlich hatte der Aktuar den Einfall, ihm ein Stück Papier und einen Bleistift vorzuhalten, danach griff der wunderliche Mensch, und malte mit kindisch-großen Buchstaben langsam den Namen Caspar Hauser. Hierauf wankte er in eine Ecke, brach förmlich zusammen und fiel in tiefen Schlaf. Weil Caspar Hauser, so wurde der Fremdling von nun ab genannt, bei seiner Ankunft in der Stadt bäurisch gekleidet war, nämlich mit einem Frack, von dem die Schöße abgeschnitten waren, einem roten Schlips und großen Schaftstiefeln, glaubte man zuerst, es mit einem Bauernsohn aus der Gegend zu tun zu haben, der auf irgendeine Weise vernachlässigt oder in der Entwicklung verkümmert war. Der erste, der dieser Meinung entschieden widersprach, war der Gefängniswärter auf dem Turm. »So sieht kein Bauer aus«, sagte er und deutete auf das wallende hellbraune Haar seines Häftlings, das etwas nicht ausdrückbar Unberührtes hatte und glänzend war wie das Fell von Tieren, die in Finsternis zu leben gewohnt sind. »Und diese feinen weißen Händchen und diese sammetweiche Haut und die dünnen Schläfen und die deutlichen blauen Adern zu beiden Seiten des Halses, wahrhaftig, er gleicht eher einem adligen Fräulein als einem Bauern.« »Nicht übel bemerkt«, meinte der Stadtgerichtsarzt, der in seinem zu Protokoll gegebenen Gutachten neben diesen Merkmalen die besondere Bildung der Knie und die hornhautlosen Fußsohlen des Gefangenen hervorhob. »So viel ist klar hieß es am Schluß, daß man es hier mit einem Menschen zu tun hat, der nichts von seinesgleichen ahnt, nicht ißt, nicht trinkt, nicht fühlt, nicht spricht wie andre der nichts von gestern, nichts von morgen weiß, die Zeit nicht begreift, sich selber nicht spürt.« (…)
Erziehungsroman
Friedrich Schlegel (1772 – 1829) : Lucinde (1799) (Ich-Erzähler; Briefroman)
Christopf Martin Wieland (1733 – 1813) Die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva (1763) CHARAKTER EINER ART VON TANTEN In einem alten baufälligen Schloss der spanischen Provinz Valencia lebte vor einigen Jahren ein Frauenzimmer von Stand, die zu der Zeit, da sie in der folgenden Geschichte ihre Rolle spielte, bereits über ein halbes Jahrhundert unter dem Namen Dona Mencia von Rosaiva - sehr wenig Aufsehen in der Welt gemacht hatte. Die Dame hatte die Hoffnung, sich durch ihre persönlichen Annehmlichkeiten zu unterscheiden, schon seit dem Sukzessionskrieg auf gegeben, in dessen Zeiten sie zwar jung und nicht ungeneigt gewesen war, einen würdigen Liebhaber glücklich zumachen, aber immer so empfindliche Kränkungen von der Kaltsinnigkeit der Männer erfahren hatte, dass sie mehr als einmal in Versuchung geraten war, in der Abgeschiedenheit einer Klosterzelle ein Herz, dessen die Welt sich so unwürdig bezeigte, dem Himmel aufzuopfern. Allein ihre Klugheit ließ sie jedes Mal bemerken, dass dieses Mittel, wie alle diejenigen, welche der Unmut einzugeben pflegt, ihre Absicht nur sehr unvollkommen erreichen und in der Tat die Undankbarkeit der Welt nur an ihr selbst bestrafen würde. Sie besann sich also glücklicherweise eines ändern, welches ihr nicht so viel kostete und weit geschickter war, die einzige Absicht zu befördern, die bei so bewandten Umständen ihrer würdig zu sein schien. Sie wurde eine Spröde und nahm sich vor, ihre beleidigten Reize an all den Unglückseligen zu rächen, welche sie als Wolken ansah, die den Glanz derselben aufgefangen und unkräftig gemacht hatten. Sie erklärte sich öffentlich für eine abgesagte Feindin der Schönheit und Liehe und warf sich hingegen zur Beschützerin aller dieser ehrwürdigen Vestalinnen auf, denen die Natur die Gabe der transitiven Keuschheit mitgeteilt hat, von Geschöpfen, deren bloßer Anblick hinlänglich wäre, den mutwilligsten Faun - weise zu machen. Dona Mencia ließ es nicht bei der bloßen Freundschaft bewenden, die der nähere Umgang, die Sympathie und die Ähnlichkeit ihres Schicksals zwischen ihr und einigen Frauenzimmern von dieser Klasse stiftete, mit denen sie zu Valencia, wo sie erzogen worden war, nach und nach Bekanntschaft gemacht hatte. Sie richtete eine Art von Schwesterschaft, mit ihnen auf, die in der schönen Welt eben das war, was (nach vieler Leute Meinung) die Mönchsorden in der politischen sind, ein Staat im Staate, dessen Interesse ist, dem anderen allen möglichen Abbruch zu tun, und die sich den Namen der Antigrazien erwarb, indem sie mit dem ganzen Reich der Liebe in einer ebenso offenbaren und unversöhnlichen Fehde stand wie die Malteserritter mit den Muselmanen. Um ihre Zusammenkünfte dem gemeinen Wesen so nützlich zu machen, wie sie ihnen selbst angenehm waren, erwählten sie die Beförderung der Tugend und der guten Sitten unter ihrem Geschlecht zum Gegenstand ihrer großmütigen Bemühungen: denn die klägliche Verderbnis desselben war, ihrem Urteil nach, die wahre und einzige Quelle allen Unheils in der Welt. Sie legten zum Grund ihrer Sittenlehre, dass die Besitzerin eines angenehmen Gesichts unmöglich tugendhaft sein könne; und nach diesem Grundsatz wurden alle ihre Urteile über die Handlungen und den moralischen Wert einer jeden Person ihres Geschlechts bestimmt. Ein Frauenzimmer, welches gefiel, war in ihren Augen eine Unglückselige, ein verlorenes Geschöpf, eine Pest der menschlichen Gesellschaft, ein Gefäß und Werkzeug der bösen Geister, eine Harpyie, Hyäne, Sirene und Amphisbäne; und alles dieses und noch etwas Ärgeres, je nachdem sie mehr oder weniger von dem ansteckenden Gift bei sich führte, welches nach dem System dieser Sittenlehrerinnen ebenso tödlich für die Tugend wie schmeichelhaft für die Eigenliebe und verführerisch für die armen Mannsleute ist. In diesem strengen Charakter hatte sich Dona Mencia bereits über fünfzehn Jahre der schönen Welt zu Valencia furchtbar gemacht, als Don Pedro von Rosaiva, ihr Bruder, den Entschluss fasste, Madrid zu verlassen, wo er den Rest eines im Dienst des neuen Königs aufgewandten Vermögens verzehrt hatte, um eine Pension nachzusuchen, die er nicht erhielt, und nun (da es zu spät war) nicht wenig bedauerte, dass er ihn nicht lieber angewandt hatte, ein kleines altes Schloss, zwei oder drei Stunden von Xelva. das einzige, was ihm von seinen Voreltern übrig war, in einen bewohnbaren Stand zu setzen. Er hatte von seiner vor kurzem verstorbenen Gemahlin einen Sohn und eine Tochter, deren zartes Alter sowohl wie die Regierung seines kleinen Hauswesens eine weibliche Aufsicht erforderten. Er übertrug dieses Amt seiner Schwester, welche leicht zu bewegen war, die Demütigungen, die sie in Valencia erlitten hatte, gegen das Vergnügen zu vertauschen, die vornehmste Frau in einem Dorf zu sein. Eine Denkart, die sie vielleicht dem großen Julius Cäsar abgelernt haben mochte, der bei seinem Durchzug durch ein elendes Städtchen in den Pyrenäen seine Freunde versicherte, dass er lieber der Erste in diesem armseligen Städtchen als der Zweite in Rom sein möchte. Der Gram über fehlgeschlagene Hoffnungen ließ den guten Don Pedro die Annehmlichkeiten der Freiheit und des Landlebens, dessen wahre Vorteile ohnehin seinen Landsleuten noch unbekannt sind, nicht lange genießen. Er starb und hinterließ seinem Sohn, Don Sylvio, einen Stammbaum, der sich in den Zeiten des Gargaris und Habides verlor, ein verfallenes Schloss mit drei Türmen, ein Paar Pachthöfe und die Hoffnung, nach dem Tode der Dona Mencia eine Erbschaft von alten Juwelen, Brillen und Rosenkränzen nebst einem ansehnlichen Vorrat von Ritterbüchern und Romanen mit seiner Schwester zu teilen. Don Pedro starb desto ruhiger, da er seinen Sohn, ob er gleich das zehnte Jahr kaum erreicht hatte, in den Händen einer so weisen Dame ließ, wie Dona Mencia in seinen Augen war. Denn ihre erstaunliche Belesenheit in Chroniken und Ritterbüchern und die Beredsamkeit, womit sie ihre tiefen Einsichten in die Staatswissenschaft und Sittenlehre bei Tische und bei anderen Gelegenheiten auszulegen pflegte, hatten ihm eine desto größere Meinung von ihrem Verstande beigebracht, je weniger seine eigene kriegerische Lebensart ihm Zeit gelassen hatte, mehr Kenntnis von dem, was man die feinere Gelehrtheit heißt, zu erwerben, als etwa das wenige sein mochte, was ihm aus seinen Schuljahren in einem nicht allzu getreuen Gedächtnis übriggeblieben war. Zweites Kapitel WAS FÜR EINE ERZIEHUNG DON SYLVIO VON SEINER TANTE BEKAM (…)
Entwicklungsroman (s. Bildungsroman)
Gottfried Keller ( 18 19 – 1890) Der Grüne Heinrich (Er-Fassung – 1. Fassung) Zu den schönsten vor allen in der Schweiz gehören diejenigen Städte, welche an einem See und an einem Flusse zugleich liegen, so daß sie wie ein weites Tor am Ende des Sees unmittelbar den Fluß aufnehmen, welcher mitten durch sie hin in das Land hinauszieht. So Zürich, Luzern, Genf; auch Konstanz gehört gewissermaßen noch zu ihnen. Man kann sich nichts Angenehmeres denken als die Fahrt auf einem dieser Seen, z. B. auf demjenigen von Zürich. Man besteige das Schiff zu Rapperswyl, dem alten Städtchen unter der Vorhalle des Urgebirges, wo sich Kloster und Burg im Wasser spiegeln, fahre, Huttens Grabinsel vorüber, zwischen den Ufern des länglichen Sees, wo die Enden der reichschimmernden Dörfer in einem zusammenhängenden Kranze sich verschlingen, gegen Zürich hin, bis, nachdem die Landhäuser der Züricher Kaufleute immer zahlreicher wurden, zuletzt die Stadt selbst wie ein Traum aus den blauen Wassern steigt und man sich unvermerkt mit erhöhter Bewegung auf der grünen Limath unter den Brücken hinwegfahren sieht. Das ganze Treiben einer geistig bedeutsamen und schönen Stadt drängt sich an den leicht dahinschwebenden Kahn. Soeben versammelt sich der gesetzgebende Rat der Republik. Trommelschlag ertönt. In einfachen schwarzen Kleidern, selten vom neuesten Schnitte, ziehen die Vertreter des Volkes auf den Ufern dahin. Auch die Gesichter dieser Männer sind nicht immer nach dem neusten Schnitte und verraten durchschnittlich weder elegante Beredsamkeit noch große Belesenheit; aber aus gewissen Strahlen der lebhaften Augen leuchtet Besonnenheit, Erfahrung und das glückliche Geschick, mit einfachem Sinn das Rechte zu treffen. Von allen Seiten wandeln diese Gruppen, je nach den Tagesfragen und der verschiedenen Richtung begrüßt oder unbegrüßt vom zahlreichen emsigen Volke, nach dem dunkeln schweren Rathause, das aus dem Flusse emporsteigt. Stolz neben diesen Gestalten hin rasseln diplomatische Fremdlinge über die Brücken in wunderlichem Aufputze, und ihre komischen Livreen ergötzen, wie billig, einen Augenblick lang das einfache Volk. Zwischendurch steuert der deutsche Gelehrte mit gedankenschwerer Stirne nach seinem Hörsaal; sein Herz ist nicht hier, es weilt im Norden, wo seine tiefsinnigen Brüder, in zerrissenen Pergamenten lesend, finstere Dämonen beschwörend, sich ein Vaterland und ein Gesetz zu gründen trachten. Ausgeworfen von der Gärung dieses großen Experimentes, begegnet ihm der Flüchtling mit unsichern, zweifelhaften Augen und kummervollen Mienen und vermehrt die Mannigfaltigkeit und Bedeutung dieses Treibens. Jetzt ertönt das Getöse des Marktes von einer breiten Brücke über unserm Kopfe; Gewerk und Gewerb summt längs des Flusses und trübt ihn teilweise, bis die rauchende Häusermasse einer der größten industriellen Werkstätten voll Hammergetönes und Essensprühen das Bild schließt. Aus dem pfeilschnell vorübergeflossenen Gemälde haben sich jedoch zwei Bilder der Vergangenheit am deutlichsten dem Sinne eingeprägt: rechts schaute Vom Münsterturme das sitzende riesige Steinbild Karls des Großen, eine goldene Krone auf dem Lockenhaupt, das goldene Schwert auf den Knien, über Strom und See hin; links ragte auf steilem Hügel, turmhoch über dem Flusse, ein uralter Lindenhain, wie ein schwebender Garten und in den schönsten Formen, grün in den Himmel. Kinder sah man in der Höhe unter seinen Laubgewölben spielen und über die Brustwehr herabschauen. Aber schon fährt man wieder zwischen reizenden Landhäusern und Gewerben, zwischen Dörfern und Weinbergen dahin, die Obstbäume hangen ins Wasser, zwischen ihren Stämmen sind Fischernetze ausgespannt. Voll und schnell fließt der Strom, und indem man unversehens noch ein Mal zurückschaut, erblickt man im Süden die weite schneereine Alpenkette wie einen Lilienkranz auf einem grünen Teppich liegen. Jetzt lauscht ein stilles Frauenkloster hinter Uferweiden hervor, und da nun gar eine mächtige Abtei aus dem Wasser steigt, so befürchtet man die schöne Fahrt wieder mittelalterlich zu schließen; aber aus den hellgewaschenen Fenstern des durchlüfteten Gotteshauses schauen statt der vertriebenen Mönche blühende Jünglinge herab, die Zöglinge einer Volkslehrerschule. So landet man endlich zu Baden, in einer ganz veränderten Gegend. Wieder liegt ein altes Städtchen mit mannigfachen Türmen und einer mächtigen Burgruine da, doch zwischen Hügeln und Gestein, wie man sie auf den Bildern der altdeutschen Maler sieht. Auf der gebrochenen Veste hat ein deutscher Kaiser das letzte Mahl eingenommen, eh er erschlagen wurde; jetzt hat sich der Schienenweg durch ihre Grundfelsen gebohrt. (…) So haben Luzern oder Genf ähnliche und doch wieder ganz eigene Reize ihrer Lage an See und Fluß. Die Zahl dieser Städte aber um eine eingebildete zu vermehren, um in diese, wie in einem Blumenscherben, das grüne Reis einer Dichtung zu pflanzen, möchte tunlich sein: indem man durch das angeführte, bestehende Beispiel das Gefühl der Wirklichkeit gewonnen hat, bleibt hinwieder dem Bedürfnisse der Phantasie größerer Spielraum und alles Mißtrauen wird verhütet. (…) Unter einer offenen Halle dieses Waldes ging am frühsten Ostermorgen ein junger Mensch; er trug ein grünes Röcklein mit übergeschlagenem schneeweißen Hemde, braunes dichtwallendes Haar und darauf eine schwarze Samtmütze, in deren Falten ein feines weiß und blaues Federchen von einem Nußhäher steckte. Diese Dinge, nebst Ort und Tageszeit, kündigten den zwanzigjährigen Gefühlsmenschen an. Es war Heinrich Lee, der heute von der bisher nie verlassenen Heimat scheiden und in die Fremde nach Deutschland ziehen wollte; hier herausgekommen, um den letzten Blick über sein schönes Heimatland zu werfen, beging er zugleich den Akt eines Naturkultus, wie es häufig bei hoffnungsreichen und enthusiastischen Jünglingen geschieht. So wenig, außer dem tiefen ruhigen Strömen des Flusses, ein Ton in dieser Frühe hörbar wurde, ebenso wenig war an der weiten tiefen himmlischen Kristallglocke der leiseste Hauch eines Wölkleins zu sehen. Der weite See verschmolz mit den Füßen des Hochgebirges in eine LSaugraue Dämmerung; die Schneekuppen und Hörner standen milchblaß in der Frühe. Als Heinrich an den Rand des Waldes trat, überflog der erste Rosenschimmer der nahenden Sonne die geisterhaften Gebilde; über dem letzten einsamen Eisaltar glimmte noch der Morgenstern. Indem unser Knabe starr nach ihm hinsah, tat er einen jener stummen, flüchtigen Gebetseufzer, die, wenn sie in Worte zu fassen wären, ungefähr so lauten würden: Das ist sehr schön, o Gott! ich danke dir dafür, ich gelobe, das Meinige auch zu tun! Wo und wer du auch seist, habe Nachsicht mit mir, du weißt, wie alles kommt in deiner Welt,übrigens mache mit mir, was du willst! Die Brust des jungen Menschen hob und senkte sich sehr stark; aber seine Seele war so keusch, daß er vor allem pathetischen Verweilen, vor aller Selbstgefälligkeit solcher Augenblicke floh, ehe sich obige wenigen Sätze in seinem Sinne deutlich entwickeln konnten. Also drehte er sich wie der Blitz auf seinem Absatze herum und eilte, nach Norden und Westen zu schauen. Die Sonne war aufgegangen; während im Süden die Alpenkette nun im fröhlichsten hellsten Golde glänzte, hatte das westliche und nördliche flache Land, gegen das Rheingebiet hin, die Rosenfarbe des Morgens angenommen, besonders wo sich die laublosen, für diese Farbe empfänglichen Waldungen und violetten Brachfelder dehnten; was junggrünes Saatland war, schimmerte mehr silbergrau in der Feme. Von Schnee war außer dem Gebirge keine Spur mehr zu finden; aber das wenige Grün war noch trocken und taulos. Die Tiefe des Himmels und mit ihr das Gewässer waren jetzt blau und das Land sonnig geworden. Nur der untere Teil der Stadt und der Fluß lagen noch im Schatten und letzterer ging tief grün, und bloß die länglich ziehenden Spiegel seiner Wellen warfen von ihren glattesten Stellen etwas Blau zurück. Heinrich Lee sah in seine Vaterstadt hinüber. Die alte Kirche badete im Morgenschein, hie und da blitzte auch ein geöffnetes Fenster, ein Kind schaute heraus und sang, und man konnte aus der Tiefe der Stube die Mutter sprechen hören, die es zum Waschen rief. Die vielen Gäßchen, durch mannigfaltiges steinernes Treppenwerk unterbrochen und verbunden, lagen noch alle im Schatten und nur wenige freiere Kinder-Spielplätze leuchteten bestreift aus dem Dunkel. Auf allen diesen Stufen und Geländern hatte Heinrich gesessen und gesprungen, und die Kinderzeit dünkte ihm noch vor der Türe des gestrigen Abends zu liegen. Schnell ließ er seine Augen treppauf und ab in allen Winkeln der Stadt herum springen, die traulichen Kinderplätze waren alle still und leer wie Kirchenstühle am Werktag. Das einzige Geräusch kam noch vom großen Stadtbrunnen, dessen vier Röhren man den Flußgang hindurch glaubte rauschen zu hören; die vier Strahlen glänzten hell, ebenso was an dem steinernen Brunnenritter vergoldet war, sein Schwertknauf und sein Brustharnisch, welch letzterer die Morgensonne recht eigentlich auffing, zusammenfaßte und sein funkelndes Gold wunderbar aus der dunkelgrünen Tiefe des Stromes heraus Widerscheinen ließ. Dieser reiche Brunnen stand auf dem hohen Platze vor dem noch reicheren Kirchenportale und sein Wasser entsprang auf dem Berge diesseits des Flusses, auf welchem Heinrich jetzt stand. Es war früher sein liebstes Knabenspiel gewesen, hier oben ein Blatt oder eine Blume iin die verborgene Quelle zu stecken, dann neben den hölzernen Röhren hinab, über die lange Brücke die Stadt hinauf zu dem Brunnen zu laufen und sich zu freuen, wenn zu gleicher Zeit oben das Zeichen aus der Röhre in das Becken sprang; manchmal kam es auch nicht wieder zum Vorschein. Er pflückte eine eben aufgehende Primel und eilte nach der Brunnenstube, deren Deckel er zu heben wußte; dann eilte er die unzähligen Stufen zwischen wucherndem Epheugewebe hinunter, über den Kirchhof, wieder hinunter, durch das Tor über die Brücke, unter welcher die Wasserleitung auch mit hinüberging. Doch auf der Mitte der Brücke, von wo man unter den dunklen Bogen des Gebälkes die schönste Aussicht über den glänzenden See hin genießt, selbst über dem Wasser schwebend, vergaß er seinen Beruf und ließ das arme Schlüsselblümchen allein den Berg wieder hinaufgehen. Als er sich endlich erinnerte und zum Brunnen hinanstieg, drehte es sich schon emsig in dem Wirbel unter dem Wasserstrahle herum und konnte nicht hinaus kommen. Er steckte es zu dem Federchen auf seiner Mütze und schlenderte endlich seiner Wohnung zu durch alle die Gassen, in welche überall die Alpen blau und silbern hineinleuchteten. Jedes Bild, klein oder groß, war mit diesem bedeutenden Grunde versehen: vor der niedrigen Wohnung armer Leute stand Heinrich still und guckte durch die Fensterlein, die, einander entsprechend, an zwei Wänden angebracht waren, quer durch das braune Gerumpel in die blendende Ferne, welche durch das jenseitige Fenster der Stube glänzte. Er sah bei dieser Gelegenheit den grauen Kopf einer Matrone nebst einer kupfernen Kaffeekanne sich dunkel auf die Silberfläche einer zehn Meilen fernen Gletscherfirne zeichnen und erinnerte sich, daß er dieses Bild unverändert gesehen, seit er sich denken mochte. So spielte dieser Jüngling wie ein Kind mit der Natur und schien seine bevorstehende, für seine kleinen Verhältnisse bedeutungsvolle Abreise ganz zu vergessen. Allein plötzlich fiel es ihm schwer aufs Herz, als er nun vor seinem düstern Vaterhause stand und die Mutter ihm ungeduldig aus dem Fenster winkte. Schnell eilte er die engen Treppen hinauf, den Wohngemächern der Haushaltungen vorbei, die alle im Hause wohnten. »Wo bleibst du denn so lang?« empfing ihn die Frau Lee, eine geringe Frau von etwa fünfundvierzig Jahren, an welcher weiter nichts auffiel als daß sie noch kohlschwarze schwere Haare hatte, was ihr ein ziem lieh junges Ansehen gab; auch war sie um einen Kopf kleiner als ihr Sohn. »Da habe ich schon angefangen, deinen Koffer zu packen, weil du sonst vor Abgang der Post nicht mehr fertig würdest.« Heinrich guckte in den Koffer; mit richtigem Sinn hatte die gute Frau Mappen und Bücher auf den Boden gebreitet; nur hatte sie mit weniger Zartheit verschiedene Bogen und Papiere nicht genugsam zusammengeschichtet, so daß einige derselben an den Wänden des Koffers gekrümmt wurden, was der Sohn eifrig verbesserte. Für Papier haben die meisten Hausfrauen überhaupt nicht viel Gefühl, weil es nicht in ihren Bereich gehört. Die weiße Leinwand ist ihr Papier, die muß in großen, wohlgeordneten Schichten vorhanden sein, da schreiben sie ihre ganze Lebensphilosophie, ihre Leiden und ihre Freuden darauf. Wenn sie aber einmal ein wirkliches Briefchen schreiben wollen, so findet sich kaum ein veraltetes Blatt dazu und man kann sich alsdann mit einem hübschen Bogen Postpapier und einer wohlgeschnittenen Feder sehr beliebt bei ihnen machen. (…)
Jugendroman s. Goethe-Institut (Kinder - und Jugendportal) Künstlerroman: Künstlererzählung
Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773 – 1798) Schilderung der dramatischen Arbeiten des Meistersingers Hans Sachs Wenn je die deutsche Poesie in irgendeiner Periode, Volkspoesie war, so war sie es im 16. Jahrhundert, dem Hauptzeitpunkte der Meistersänger. Handwerke und Künste blühten; der Bürger lebte im Wohlstande; - es war das goldne Alter des deutschen Kunstfleißes. Vornehmlich passen diese Züge auf einige damals weitberühmte Städte, unter denen Nürnberg den ersten Rang behauptete. Gewiß hatte auch jene bürgerliche Poesie gute Wirkungen, und verbreitete eine gewisse Bildung auch unter der niedrigeren Klasse. Ihre Hauptzwecke waren: Beförderung der Religion, - und der Moralität: Hans Sachs, der als Haupt der Dichtkunst verehrt ward, gibt diese Zwecke mehrmals deutlich an; und wir sehen auch aus seinen Werken hinlänglich, daß er sie beständig vor Augen gehabt hat. Um religiöse Gesinnungen, und zugleich die in dem heiligen Buche der Christen enthaltenen interessanten und lehrreichen Geschichten unter seinen Mitbürgern gemein zu machen, brachte er, stückweise, und in verschiedenen Arten der Behandlung, fast die ganze Bibel in Versen: eine Arbeit, der durchaus alles poetische Verdienst mangelt, die aber in jenen Zeiten, da die Bibel ein neu aufgegrabener, und noch von wenigen genutzter Schatz war, sehr nützlich sein konnte. Der gemeine Mann ward mit dem Inhalte der Bibel vertrauter, nachdem der allgemein beliebte Volksdichter denselben in seine Manier gekleidet hatte; stückweise lernte er mit leichterer Mühe das Ganze kennen, und der Reim prägte Worte und Sinn ihm tiefer ein. – Was die Moral in Hans Sachsens Werken betrifft, so sieht man deutlich, daß diese sein allgemeinster Zweck war. Fast kein einziges seiner Tausende von Gedichten, läßt er aus der Hand, ohne einen <Beschluß>, wie er es nennt, anzuhängen, worin eine oder mehrere Lehren aus dem Gedichte gezogen, und meistenteils mit höchst gedehnter Weitschweifigkeit auseinandergesetzt, und dein Leser ans Herz gelegt werden. Überall findet er Gelegenheit, moralische Anwendungen anzuknüpfen; er erzählt fast keine Anekdote ohne dem; - er bringt lange, trockene Verzeichnisse von Tieren und Vögeln in Reime, um die Natur jedes Tiers allegorisch auf einen menschlichen, guten oder bösen Charakter zu deuten; - er versifiziert unendlich viele Stücke aus alten und neuen Geschichtsschreibern nicht bloß, um seine Leser mit den merkwürdigen Vorfällen der Zeiten bekannt zu machen, sondern hauptsächlich, um darin Charaktere und Handlungen, zur Nachahmung oder zum Abscheu aufzustellen. Wo Belehrung, moralische Belehrung, der Hauptzweck der Dichtkunst ist, da wohnt ihr echter Genius nicht. So war es bei uns fast durchaus der Fall im Mittelalter. Dazu kam noch überdies, daß die deutsche Sprache im 16. Jahrhundert viel zu wenig ausgebildet war, als daß sich eine eigene poetische Sprache von ihr hätte absondern können; welches um so weniger möglich sein konnte, da die besondere Gattung der Poesie, von der hier die Rede ist, auf die niedere Klasse mechanischer Handarbeiter eingeschränkt war, die in ihrem Ausdruck nicht leicht über den Bezirk der gemeinen Volkssprache hinauszutreten, und zur reinen Kunstschönheit zu gelangen vermochten. Und dennoch wurden sie sehr geschätzt. Ihrem Ideenkreise und ihrer Sprache gemäß, läßt sich schon im allgemeinen vermuten, daß sie in der niedrigkomischen, burlesken Poesie am glücklichsten gewesen sein müßten; und gerade dies Fach ist es auch vornehmlich, worin die unparteiische Nachwelt unserem Hans Sachs wahres Verdienst zugestehen muß. Einige seiner Schwänke sind in Ausdruck und Erfindung, -(denn die, bei denen er keine Quelle angibt, sind doch wahrscheinlich mehrenteils aus seinem eigenen Kopf,) Meisterstücke in ihrer Art. Außer ihnen ist Hans Sachs nur in einigen allegorischen Phantasien, (Gesprächen allegorischer Personen, usw.) wahrer Dichter, und Erfinder; denn sonst sind seine Gegenstände durchaus entlehnt. Diese allegorischen Stücke in denen auch eine in ihren Zügen zwar immer einförmige, aber doch romantische und angenehme Einbildungskraft herrscht, gehören zu den Arbeiten seiner früheren Jahre. Man bemerkt bei der Ansicht seiner Werke sehr bald, daß er in seinen älteren Jahren fast nur Historien, und Stücke aus der Bibel in gereimte Erzählungen, oder in Schauspiele verwandelte, und daß auch in der Ausführung alles auffallend trockener und nüchterner wird. Er macht im Alter aus einigen seiner Erzählungen, Schauspiele, und aus einigen seiner Schwänke, Fastnachtspiele, vermehrte auch einige seiner Schauspiele mit Akten und Personen. Und im einzelnen wiederholte er sich noch mehr. Aber seinen Hang, alles was er las, und was er nur einigermaßen lehrreich fand, in Verse umzugießen, konnte er bis in sein spätes Alter nicht aufgeben. (…) Künstlerroman Ludwig Tieck ( 1773 – 1853) Franz Sternbalds Wanderungen. Eine altdeutsche Geschichte (1798)
So sind wir denn endlich aus den Toren der Stadt", sagte Sebastian, indem er stille stand und sich freier umsah. „Endlich?" antwortete seufzend Franz Sternbald sein Freund. -„Endlich? Ach nur zu früh, allzu früh." Die beiden Menschen sahen sich bei diesen Worten lange an, und Sebastian legte seinem Freunde zärtlich die Hand an die Stirne und fühlte, daß sie heiß sei. - „Dich schmerzt der Kopf", sagte er besorgt, und Franz antwortete: „Nein, das ist es nicht, aber daß wir uns nun bald trennen müssen." „Noch nicht!" rief Sebastian mit einem wehmütigen Erzürnen aus, „so weit sind wir noch lange nicht, ich will dich wenigstens eine Meile begleiten." Sie gaben sich die Hände und gingen stillschweigend auf einem schmalen Wege nebeneinander. Jetzt schlug es in Nürnberg vier Uhr und sie zählten aufmerksam die Schläge, obgleich beide recht gut wußten, daß es keine andre Stunde sein konnte: indem warf das Morgenrot seine Flammen immer höher, und es gingen schon undeutliche Schatten neben ihnen, und die Gegend trat rundumher aus der Ungewissen Dämmerung heraus; da glänzten die goldenen Knöpfe auf den Türmen des heiligen Sebald und Laurentius, und rötlich färbte sich der Duft, der ihnen aus den Kornfeldern entgegenstieg. . . „Wie alles noch so still und feierlich ist", sagte Franz, „und bald werden sich diese guten Stunden in Saus und Braus, in Getümmel und tausend Abwechselungen verlieren. Unser Meister schläft wohl noch und arbeitet an seinen Träumen, seine Gemälde stehn aber auf der Staffele! und warten schon auf ihn. Es tut mir doch leid, daß ich ihm den Petrus nicht habe können ausmalen helfen." „Gefällt er dir?" fragte Sebastian. „Über die Maßen", rief Franz aus, „es sollte mir fast bedünken, als könnte der gute Apostel, der es so ehrlich meinte, der mit seinem Degen so rasch bei der Hand war und nachher doch aus Lebensfurcht das Verleugnen nicht lassen konnte, und sich von einem Han musste eine Buß- und Gedächtnispredigt halten lassen; als wenn ein solcher beherzter und furchtsamer, starker und gutmütiger Ap0stel nicht anders habe aussehen können, als ihn Meister Dürer so vor uns hingestellt hat. Wenn er dich zu dem Bilde läßt, lieber Sebastian, so wende ja. allen deinen Fleiß darauf und denke nicht, daß es für ein schlechtes Gemälde gut genug sei. Willst du mir das versprechen?" Er nahm ohne eine Antwort zu erwarten seines Freundes Hand und drückte sie stark, Sebastian sagte: „Deinen Johannes will ich recht aufheben und ihn behalten, wenn man mir auch viel Geld dafür böte." Mit diesen Reden waren sie an einen Fußsteig gekommen, der einen nähern Weg durch das Korn führte. Rote Lichter zitterten an den Spitzen der Halme und der Morgenwind rührte sich darin und machte Wellen. Die beiden Jungen Maler unterhielten sich noch von ihren Werken und von ihren Planen für die Zukunft: Franz verließ jetzt Nürnberg, die herrliche Stadt, in der er seit zwölf Jahren gelebt hatte und in ihr zum Jüngling erwachsen war, aus diesem befreundeten Wohnort ging er heut, um in der Ferne seine Kenntnis zu erweitern und nach einer mühseligen Wanderschaft dann als ein Meister in der Kunst der Malerei zurückzukehren; Sebastian aber blieb noch bei dem wohlverdienten Albrecht Dürer, dessen Name im ganzen Lande ausgebreitet war. Jetzt ging die Sonne in aller Majestät hervor und Sebastian und Franz sahen abwechselnd nach den Türmen von Nürnberg zurück, deren Kuppeln und Fenster blendend im Schein der Sonne glänzten. Die jungen Freunde fühlten stillschweigend den Druck des Abschieds, der ihrer wartete, sie sahen jedem kommenden Augenblick mit Furcht entgegen, sie wußten, daß sie sich trennen mußten und konnten es doch immer noch nicht glauben. „Das Korn steht schön", sagte Franz, um nur das ängstigende Schweigen zu unterbrechen, „wir werden eine schöne Ernte haben." „Diesmal", antwortete Sebastian, „werden wir nicht miteinander das Erntefest besuchen, wie seither geschah; ich werde gar nicht hingehn, denn du fehlst mir und all das lustige Pfeifen und Schalmeigetöne würde nur ein bittrer Vorwurf für mich sein, daß ich ohne dich käme." Dem jungen Franz standen bei diesen Worten die Tränen in den Augen, denn alle Szenen, die sie miteinander gesehn, alles, was sie in brüderlicher Gesellschaft erlebt hatten, ging schnell „Wirst du mich auch in der Ferne noch immer lieb behalten?" konnte er sich nicht mehr fassen, sondern fiel dem Fragenden mit lautem Schluchzen um den Hals und ergoß sich in tausend Tränen, er zitterte, es war, als wenn ihm das Herz zerspringen wollte. Sebastian hielt ihn fest in seinen Armen, und mußte mit ihm weinen, ob er gleich älter und von einer härteren Konstitution war. „Komme wieder zu dir!" sagte er endlich zu seinem Freunde, „wir müssen uns fassen, wir sehn uns ja wohl wieder." Franz antwortete nicht, sondern trocknete seine Tränen ab, ohne sein Gesicht zu zeigen. Es liegt im Schmerze etwas, dessen sich der Mensch schämt, er mag seine Tränen auch vor seinem Busenfreunde, auch wenn sie diesem gehören, gern verbergen. Sie erinnerten sich nun daran, wie sie schon oft von dieser Reise gesprochen hätten, wie sie ihnen also nichts weniger als unerwartet käme, wie sehr sie Franz gewünscht und sie immer als sein höchstes Glück angesehn habe. Sebastian konnte nicht begreifen, warum sie jetzt so traurig wären, da im Grunde nichts vorgefallen sei, als daß nun endlich der langgewünschte Augenblick wirklich herbeigekommen sei. Aber so ist das Glück des Menschen, er kann sich dessen nur freuen, wenn es aus der Ferne auf ihn zuwandelt; kömmt es ihm nahe und ergreift seine Hand, so schaudert er oft zusammen, als wenn er die Hand des Todes faßte. „Soll ich dir die Wahrheit gestehn?" fuhr Franz fort; „du glaubst nicht, wie seltsam mir gestern abend zu Sinne war. Ich hatte meinen Gedanken so oft die Pracht Roms, den Glanz Italiens vorgemalt, ich konnte mich bei der Arbeit ganz darin verlieren, daß ich mir vorstellte, wie ich auf unbekannten Fußsteigen, durch schattige Wälder wanderte, und dann fremde Städte und niegesehene Menschen meinem Blicke begegneten; ach, die bunte, ewig wechselnde Welt mit ihren noch unbekannten Begebenheiten, die Künstler, die ich sehn würde, das hohe gelobte Land der Römer, wo einst die Helden wirklich und wahrhaftig gewandelt, deren Bilder mir schon Tränen entlockt hatten; sieh, alles dies zusammen hatte oft so meine Gedanken gefangen genommen, daß ich zuweilen nicht wußte, wo ich war, wenn ich wieder aufsah. ,Und das alles soll wirklich werden!' rief ich dann manchmal aus, ,es soll eine Zeit geben können, sie tritt schon näher und näher, in der du nicht mehr vor der alten, so wohlbekannten Staffelei sitzest, eine Zeit, wo du in alle die Herrlichkeit hineinleben darfst und immer mehr sehn, mehr erfahren, nie aufwachen, wie es dir jetzt wohl geschieht, wenn du so zuzeiten von Italien träumst; - ach, wo, wo bekömmst du Sinne, Gefühle genug her, um alles treu und wahr, lebendig und urkräftig aufzufassen?' - Und dann war es, als wenn sich Herz und Geist innerlich ausdehnten und wie mit Armen jene zukünftige Zeit erhäschen, an sich reißen wollten; und nun -" „Und nun, Franz?" „Kann ich es dir sagen?" antwortete jener - „kann ich es selber ergründen? Als wir gestern abend um den runden Tisch unsers Dürers saßen und er mir noch Lehren zur Reise gab, als die Hausfrau indes den Braten schnitt und sich nach dem Kuchen erkundigte, den sie zu meiner Abreise gebacken hatte, als du nicht essen konntest, und mich immer von der Seite betrachtetest; o Sebastian, es wollte mir ganz mein armes ehrliches Herz zerreißen. Die Hausfrau kam mir so gut vor, so oft sie auch mit mir gescholten, so oft sie auch unsern braven Meister betrübt hatte; hatte sie mir doch selbst meine Wäsche eingepackt, war sie doch gerührt, daß ich abreisen wollte. Nun war unsre Mahlzeit geendigt, und wir alle waren nicht fröhlich gewesen, sosehr wir es auch uns erst in vielen Worten vorgesetzt hatten. Jetzt nahm ich Abschied von Meister Albrecht, ich wollte so hart sein und konnte vor Tränen nicht reden; ach mir fiel es zu sehr ein, wie viel ich ihm zu danken hatte, was er ein vortrefflicher Mann ist, wie herrlich er malt, und ich so nichts gegen ihn bin und er doch in den letzten Wochen immer tat, als wenn ich seinesgleichen wäre; ich hatte das alles noch nie so zusammen empfunden, und nun warf es mich dafür auch gänzlich zu Boden. Ich ging fort und du gingst stillschweigend in deine Schlafkammer: nun war ich auf meiner Stube allein. ,Keinen Abend werd ich mehr hier hereintreten', sagte ich zu mir selber, indem ich das Licht auf den Boden stellte; ,für dich, Franz, ist nun dieses Bette zum letzten Male in Ordnung gelegt, du wirfst dich noch einmal hinein und siehst diese Kissen, denen du so oft deine Sorgen klagtest, auf denen du noch öfter so süß schlummertest, nie siehst du sie wieder.' - Sebastian, geht es allen Menschen so, oder bin ich nur ein solches Kind? Es war mir fast, als stünde mir das größte Unglück bevor, das dem Menschen begegnen könnte, ich nahm sogar die alte Lichtschere mit Zärtlichkeit, mit einem wehmütigen Gefühl in die Hand und putzte damit den langen Docht des Lichtes. Ich war überzeugt, daß ich vom guten Dürer nicht zärtlich genug Abschied genommen, ich machte mir heftige Vorwürfe darüber, daß ich ihm nicht alles gesagt hatte, wie ich von ihm denke, welch ein vortrefflicher Mann er in meinen Augen sei, daß er nun von mir so entfernt werde, ohne daß er wisse, welche kindliche Liebe, welche brennende Verehrung, welche Bewunderung ich mit mir nähme. Als ich so über die alten Giebel hiniibersah, und über den engen dunkeln Hof, als ich dich nebenan gehn hörte und die schwarzen Wolken so unordentlich durch den Himmel zogen, ach! Sebastian! wie wenn ihr mich aus dem Hause würfet, als wenn ich nicht mehr euer Freund und Gesellschafter sein dürfte, als wenn ich allein als ein Unwürdiger verstoßen sei, verschmäht und verachtet - so regte es sich in meinem Busen. Ich hatte keine Ruhe, ich ging noch einmal vor Dürers Gemach und hörte ihn drinnen schlafen, o ich hätte ihn gern noch einmal umarmt, alles genügte mir nicht, ich hätte mögen dableiben, an kein Verreisen hätte müssen gedacht werden und ich wäre vergnügt gewesen. - Und noch jetzt! sieh, wie die fröhlichen Lichter des Morgens um uns spielen, und ich trage noch alle Empfindungen der dunkeln Nacht in mir. Warum müssen wir immer früheres Glück vergessen, um von neuem glücklich sein zu können? — Ach! laß uns hier einen Augenblick stille stehen, horch, wie schön die Gebüsche flüstern; wenn du mir gut bist, so singe mir hier noch einmal das alte Lied vom Reisen." Sebastian stand sogleich still und sang, ohne alle Vorbereitung, folgende Verse:
„Willt du dich zur Reis bequemen Über Feld, Berg und Tal, Durch die Welt, Fremde Städte allzumal, Mußt Gesundheit mit dir nehmen.
Neue Freunde aufzufinden Läßt die alten du dahinten, Früh am Morgen bist du wach, Mancher sieht dem Wandrer nach Weint dahinten, Kann die Freud nicht wiederfinden.
Eltern, Schwester, Bruder, Freund, Auch vielleicht das Liebchen weint, Laß sie weinen, traurig und froh Wechselt das Leben bald so bald so, Nimmer ohne Ach! und Oh! Heimat bleibt dir treu und bieder, Kehrst du nur als Treuer wieder, Reisen und Scheiden Bringt des Wiedersehens Freuden."
Franz hatte sich ins hohe Gras gesetzt und sang die letzten Verse inbrünstig mit, er stand auf und sie kamen an die Stelle, wo Sebastian hatte umkehren wollen. „Grüße noch einmal!" rief Franz aus, „alle, die mich kennen, und lebe du recht wohl." „Und du gehst nun?" fragte Sebastian; „muß ich denn nun ohne dich umkehren?" Sie hielten sich beide fest umschlossen. „Ach nur eins noch!" rief Sebastian aus, „es quält mich gar zu sehr und ich kann dich so nicht lassen." Franz wünschte den Abschied im Herzen vorüber, es war, als wenn sein Herz von diesen gegenwärtigen Minuten erdrückt würde, er sehnte sich nach der Einsamkeit, nach dem Walde, um dann von seinem Freunde entfernt seinen Schmerz ausweinen zu können. Aber Sebastian verlängerte die Augenblicke des Abschieds, weil er sich durch kein neues Leben, durch keine neue Gegend konnte trösten lassen, er kannte alles genau, wozu er zurückkehrte. „Willst du mir versprechen?" rief er aus. „Alles! alles!" „Ach Franz!" fuhr jener klagend fort, „ich lasse dich nun los und du bist nicht mehr mein, ich weiß nicht, was dir begegnet, ich kann dir nicht ins Gesicht sehen, und so setze ich deine Liebe, ja dich selbst auf ein Ungewisses Spiel. Wirst du auch noch in der weiten Ferne an deinen einfältigen Freund Sebastian denken? Ach, wenn du nun unter klugen und vornehmen Leuten bist, wenn es nun schon lange her ist, daß wir hier Abschied genommen haben, willst du mich auch dann nie verachten?" „O mein liebster Sebastian!" rief Franz schluchzend. „Wirst du immer noch Nürnberg so lieben", fuhr jener fort, „und deinen Meister, den wackern Albrecht? Wirst du dich nie klüger fühlen? 0 versprich mir, daß du derselbe Mensch bleiben willst, daß du dich nicht vom Glanz des Fremden willst verführen lassen, daß alles dir noch ebenso teuer ist, daß ich dich nochebenso angehe." „O Sebastian", sagte Franz, „mag die ganze Welt klug und überklug werden, ich will immer ein Kind bleiben." Sebastian sagte: „O wenn du einst mit fremden abgebettelten Sitten wiederkämst, alles besser wüßtest und dir das Herz nicht mehr so warm schlüge, wenn du dann mit kaltem Blute nach Dürers Grabstein hinsehn könntest und du höchstens über die Arbeit und Inschrift sprächest - o so möcht ich dich gar nicht wiedersehn, dich gar nicht für meinen Bruder erkennen." „Sebastian! bin ich denn so?" rief Franz heftig aus; „ich kenne ja dich, ich liebe ja dich und mein Vaterland, und die Stube worin unser Meister wohnt, und die Natur und Gott. Immer werd ich daran hangen, immer, immer! Sieh, hier, an diesem alten Eichenbaum versprech ich es dir, hier hast du meine Hand darauf." Sie umarmten sich und gingen stumm auseinander, nach einer Weile stand Franz still, dann lief er dem Sebastian nach und umarmte ihn wieder. „Ach, Bruder", sagte er, „und wenn Dürer den Ecce homo fertig hat, so schreibe mir doch recht umständlich wie der geworden ist und glaube ja an die Göttlichkeit der Bibel, ich weiß, daß du manchmal übel davon dachtest." „Ich will es tun", sagte Sebastian und sie trennten sich wieder, aber nun kehrte keiner um, oft wandten sie das Gesicht, ein Wald trat zwischen beide.
Psychologischer Roman: (psychologischer) Entwicklungsroman
Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) Die Leiden des jungen Werther(s) s. a. (Ich-) Erzähler im Roman - Werkstattarbeit Klausur zum Abschiedsbrief “Nach eilfe” Klausur zur “Begegnung mit Heinrich”
Karl Philip Moritz (1756 – 1793) : Anton Reiser (1785/86) (Biographie)
Stefan Zweig ( 1881 – 1942) : Ungeduld des Herzens (1938) (Ich-Erzähler) Bitte Geduld bis 2013. *
Klabund (= Klabautermann/ Vagabund : Alfred Henschke 1890 – 1928) Der Romanschriftsteller Graugelb ist sein Gesicht. Die Nase Steigt klippenspitz empor. Die Augen liegen fleckig, Misstrauisch von den Wimpern tief beschattet, Geduckt zum Sprung wie Panther in der Höhlung. Der rechte Arm mit der Zigarre steht Steif wie ein Schwert, als wolle er damit Sich von den andern sondern, die ihm widerwärtig Und dennoch so sympathisch sind. Schlägt er die Asche ab, So fällt wie Hohn sie aufs Gespräch. Ein kurzes »Ja«, ein scharfes »Nein« Wirft er zuweilen in die Unterhaltung. Mit diesem spitzen »Ja« und »Nein« Spießt er die Leute wie auf Nadeln auf Und nimmt sie mit nach Hause Für seine Käfersammlung. — — — Schlägt man das nächste Buch des Dichters auf. O Gott! Schon ist man selber drin verzeichnet, Und wer sich in gerechter Selbsterkenntnis Für ein libellenähnlich Wesen hielt, Der findet sich erstaunt als Mistbock wieder.
aus: Die Harfenjule (1927)
|
|
|