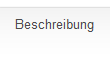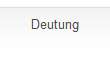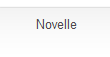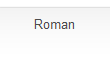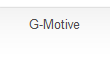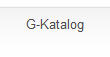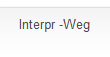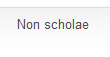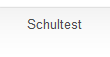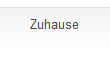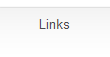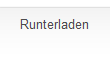|
|
|
|
|
Lyrikform: Romanze span. Heldenballaden - Heldenlieder - „Ereignislieder“ (Heusler)
Clemens Brentano (1778 – 1842) Rosablankens Traum (aus: ROMANZEN VOM ROSENKRANZ , 1804/12 – posthum 1852
In des ernsten Tales Büschen Ist die Nachtigall entschlafen, Mondenschein muß auch verblühen, Wehet schon der Frühe Atem.
Jetzt auch hält auf stummen Hügeln Einsam freudig seine Wache Phosphoros, der Held der Frühe, Strahlend, ernsthaft, sinnend, harrend.
Und es geht mit leisen Füßen, Daß der Vater nicht erwache, Rosablanka aus der Hütte, Um die Sonne zu erwarten.
Nieder sitzt sie an der Türe Und blickt betend in den Garten, Ehe noch mit grauem Flügel An dem Dach die Schwalbe raschelt.
Auf den Schattenkelchen glühen Milden Taues Diamanten; Sind es Tränen, sind es Küsse, Ists der Glanz prophetscher Flammen?
„Morgenstern, o sei gegrüßet Du, Maria voll der Gnaden, Bitte für uns arme Sünder Jetzt und in dem Tode, Amen l"
Spricht sie - und vom Stern der Frühe Weissagt auch die fromme Schwalbe, Und des Traumes schwülen Flügel Spannt sie über Rosablanken.
Auf der goldnen Locken Fülle, Schwer vom blanken Nacken wallend, Sinkt ihr schlummernd Haupt zurücke, Himmelsspiegel wird die Wange.
Schüchtern um die rosgen Füße Ihr der Tau die Traumflut sammelt, Und der West mit kühlem Flüstern Dunkle Schlummersegel spannet.
Und der Traum spielt, sie berückend, Auf der Wimpern goldnen Strahlen, Die zum Schlummer sind entzücket In des Morgensternes Glänze.
Und es kreuziget die Süße Fromm gewohnt sich Stirn und Wange, Legt in Gottes Hand die Zügel Der nachtwandelnden Gedanken.
Von den lichtergrauten Hügeln Nieder zu des Tales Garten Durch die Nebelwege düster Sieht sie einen Jüngling wallen.
Zu des Gartens Rosengrüften, Wo die Düfte schlummernd schwanken, Eilet Rosablanka schüchtern; Jener folget ihrem Pfade,
Wandelt ernsthaft durch die Türe, In der Rechten einen Spaten, Und sie wagt nicht ihn zu grüßen, Also hell und finster war er.
Und sie pflückt gebückt in Züchten Süße Blümlein, die noch schlafen, Die unschuldgen, ohne Sünde, Ohne Taufe, ihm zum Kranze.
Da sie scheu den Kranz schon rundet, Steht vor ihr der trübe Wandrer, Spricht: „Wohl selig sind die Blüten, Die du tötetest im Schlafe;
Selig in der Nacht gepflücket, Die in Unschuld sind empfangen, Die nicht traf der Fluch der Sünde, Starben selig vor dem Apfel.
Aber uns tut not zu büßen, Denn das Weib ward durch die Schlange Zu dem Gottesraub verführet, Den sie teilte mit dem Manne.
Und so hat der Herr erzürnet An die Erde uns gebannet; In der Mutter muß ich wühlen Nach dem göttlichen Erbarmen.
Mit dem Fleische ist die Sünde Aus der Erde aufgegangen; In der Mutter muß ich wühlen, Bis der Vater sich erbarmet!"
Und vor Rosablankens Füßen Fing der Ernste an zu graben, Und da er die Gruft erwühlet, Hat die Erde ihn umfangen.
Mit ihm zu der Erde Grüften Sinken auch des Tales Schatten; Aus den Gründen zu den Hügeln Tritt die Nebelwoge-wachsend.
Trüb getürmt auf düstern Füßen Schwankt der Riese auf am Walde, Schwingt die Nacht auf seinen Rücken, Kalt die Nebelfäuste ballend.
Trügend rüstet sich der Lügner Mit dem Sonnengott zum Kampfe, Der auf goldnen Flügelfüßen Flammet aus den Ozeanen.
Seinen Spiegel stellt er lügend In der Dünste giftgem Walle Antichristisch ihm genüber; Jeder wache, nicht zu fallen!
Wo der Traum in irdschen Gründen Barg den Mann, will Rosablanka, Ganz in tiefer Angst entzücket, Ihren Blumenkranz begraben.
Aber ihr entgegen züngelnd Reckt sich eine bunte Schlange, Und mit heilgem Mut gerüstet Betet bebend Rosablanka:
„Sei verflucht, du Geist der Lügen, Dich zertrat des Weibes Samen; O Maria, sei gegrüßet, Mutter Gottes, voller Gnaden!
Amen!" und aus Himmelflüssen Gießt sich aus ein Meer des Glanzes: Maris Stella1 sei gegrüßet, Semper virgo, ave, salve2!
Und Aurorens Heldenfüße Traten auf das Haupt der Schlange; Kindisch ihre Schuld zu sühnen Gibt den Kranz ihr Rosablanka.
Aber auf des Tales Hügeln Glüht die Sonne und es wallen Schon die Bienen nach den Blüten, Und es eilt die fromme Schwalbe,
Kühlt des Traumes schwülen Flügel Auf dem Spiegel klarer Wasser, Und beträufelt mit dem Flügel Weckend Rosablankens Wange.
1 Stern des Meeres 2 Immerwährende Jungfrau, Gruß, Heil!
* Heinrich Heine (1797 - 1856) Don Ramiro „Donna Clara! Donna Clara! Heißgeliebte lange Jahre! Hast beschlossen mein Verderben, Und beschlossen ohn’ Erbarmen
„Donna Clara! Donna Clara? Ist doch süß die Lebensgabe! Aber unten ist es grausig, In dem dunkeln, kalten Grabe.
„Donna Clara! Freu dich, morgen Wird Fernando am Altare Dich als Ehgemahl begrüßen, - Wirst du mich zur Hochzeit laden?"
„Don Ramiro! Don Ramiro! Deine Worte treffen bitter, Bittrer als der Spruch der Sterne, Die da spotten meines Willens.
„Don Ramiro! Don Ramiro! Rüttle ab den dumpfen Trübsinn; Mädchen gibt es viel auf Erden, Aber uns hat Gott geschieden.
„"Don Ramiro, der du mutig So viel' Mohren überwunden, Überwinde nun dich selber, - Komm auf meine Hochzeit morgen."
„Donna Clara! Donna Clara! Ja, ich schwör’ es, ja, ich komme! Will mit dir den Reihen tanzen; Gute Nacht, ich komme morgen."
„Gute Nacht!" - Das Fenster klirrte. Seufzend stand Ramiro unten, Stand noch lange wie versteinert; Endlich schwand er fort im Dunkeln. -
Endlich auch nach langem Ringen, Muss die Nacht dem Tage weichen; Wie ein bunter Blumengarten Liegt Toledo ausgebreitet.
Prachtgebäude und Paläste Schimmern hell im Glanz der Sonne; Und der Kirchen hohe Kuppeln Leuchten stattlich, wie vergoldet.
Summend, wie ein Schwärm von Bienen, Klingt der Glocken Festgeläute, Lieblich steigen Betgesänge Aus den frommen Gotteshäusern.
Aber dorten, siehe! siehe! Dorten aus der Marktkapelle, Im Gewimmel und Gewoge, Strömt des Volkes bunte Menge.
Blanke Ritter, schmucke Frauen, Hofgesinde, festlich blinkend, Und die hellen Glocken läuten, Und die Orgel rauscht dazwischen.
Doch, mit Ehrfurcht ausgewichen, In des Volkes Mitte wandelt Das geschmückte junge Ehpaar, Donna Clara, Don Fernando.
Bis an Bräutigams Palasttor Wälzet sich das Volksgewühle; Dort beginnt die Hochzeitfeier, Prunkhaft und nach alter Sitte.
Ritterspiel und frohe Tafel Wechseln unter lautem Jubel; Rauschend schnell entfliehen die Stunden, Bis die Nacht herabgesunken.
Und zum Tanze sich versammeln In dem Saal die Hochzeitgäste; In dem Glanz der Lichter funkeln Ihre bunten Prachtgewänder.
Auf erhobne Stühle ließen Braut und Bräutigam sich nieder, Donna Clara, Don Fernando, Und sie tauschen süße Reden.
Und im Saale wogen heiter Die geschmückten Menschenwellen, Und die lauten Pauken wirbeln, Und es schmettern die Drommeten.
„Doch warum, o schöne Herrin, Sind gerichtet deine Blicke Dorthin nach der Saalesecke?", So verwundert sprach der Ritter.
„Siehst du denn nicht, Don Fernando, Dort den Mann im schwarzen Mantel?" Und der Ritter lächelt freundlich: „Ach, das ist ja nur ein Schatten."
Doch es nähert sich der Schatten, Und es war ein Mann im Mantel; Und Ramiro schnell erkennend, Grüßt ihn Clara, glutbefangen.
Und der Tag hat schon begonnen, Munter drehen sich die Tänzer In des Walzers wilden Kreisen, Und der Boden dröhnt und bebet.
„Wahrlich gerne, Don Ramiro, Will ich dir zum Tanze folgen, Doch im nächtlich schwarzen Mantel Hättest du nicht kommen sollen."
Mit durchbohrend stieren Augen Schaut Ramiro auf die Holde, Sie umschlingend spricht er düster: „Sprachest ja, ich sollte kommen!"
Und ins wirre Tanzgetümmel Drängen sich die beiden Tänzer; Und die lauten Pauken wirbeln, Und es schmettern die Drommeten.
„Sind ja schneeweis deine Wangen!", Flüstert Clara heimlich zitternd. „Sprachest ja, ich sollte kommen!", Schallet dumpf Ramiro's Stimme.
Und im Saal die Kerzen blinzeln Durch das flutende Gedränge; Und die lauten Pauken wirbeln, Und es schmettern die Drommeten.
„Sind ja eiskalt deine Hände!", Flüstert Clara, schauerzuckend. „Sprachest ja, ich sollte kommen!" Und sie treiben fort im Strudel.
„Las mich, las mich! Don Ramiro! Leichenduft ist ja dein Odem!" Wiederum die dunkeln Worte: „Sprachest ja, ich sollte kommen!"
Und der Boden raucht und glühet, Lustig tönet Geig' und Bratsche; Wie ein tolles Zauberweben Schwindelt alles in dem Saale.
„Las mich, las mich! Don Ramiro!" Wimmert's immer im Gewoge. Don Ramiro stets erwidert: „Sprachest ja, ich sollte kommen!"
„Nun, so geh, in Gottes Namen!" Clara rief's mit fester Stimme, Und dies Wort war kaum gesprochen, Und verschwunden war Ramiro.
Clara starret, Tod im Antlitz, Kaltumflirret, nachtumwoben; Ohnmacht hat das lichte Bildnis In ihr dunkles Reich gezogen.
Endlich weicht der Nebelschlummer, Endlich schlägt sie auf die Wimper; Aber Staunen will aufs neue Ihre holden Augen schließen.
Denn derweil der Tanz begonnen, War sie nicht vom Sitz gewichen, Und sie sitzt noch bei dem Bräut'gam: Und der Ritter sorgsam bittet:
„Sprich, was bleichet deine Wangen? Warum wird dein Äug so dunkel? -" „Und Ramiro? - -", stottert Clara, Und Entsetzen lahmt die Zunge.
Doch mit tiefen, ernsten Falten Furcht sich jetzt des Bräut'gams Stirne: „Herrin, forsch nicht blut'ge Kunde, Heute mittag starb Ramiro."
* In Abgrenzung zur gereimten Ballade:
Heinrich Heine (1797 - 1856) Die Grenadiere
Nach Frankreich zogen zwei Grenadier’, Die waren in Russland gefangen, Und als sie kamen ins deutsche Quartier, Sie ließen die Köpfe hangen.
Da hörten sie beide die traurige Mär: Daß Frankreich verloren gegangen, Besiegt und zerschlagen das große Heer, Und der Kaiser, der Kaiser gefangen.
Da weinten zusammen die Grenadier' Wohl ob der kläglichen Kunde. Der eine sprach: „Wie weh wird mir, Wie brennt meine alte Wunde!"
Der andre sprach: „Das Lied ist aus, Auch ich möchte' mit dir sterben, Doch hab' ich Weib und Kind zu Haus, Die ohne mich verderben."
„Was schert mich Weib, was schert mich Kind, Ich trage weit beßres Verlangen; Laß sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind, Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen!"
„Gewähr mir, Bruder, eine Bitt': Wenn ich jetzt sterben werde, So nimm meine Leiche nach Frankreich mit, Begrab mich in Frankreichs Erde.
Das Ehrenkreuz am roten Band Sollst du aufs Herz mir legen; Die Flinte gib mir in die Hand, Und gürt mir um den Degen.
So will ich liegen und horchen still Wie eine Schildwach im Grabe, Bis einst ich höre Kanonengebrüll Und wiehender Rosse Getrabe.
Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, Viel’ Schwerter klirren und blitzen; Dann steig' ich gewaffnet hervor aus dem Grab, Den Kaiser, den Kaiser zu schützen!"
* Heinrich Heine (1797 - 1856) Die Minnesänger
Zu dem Wettgesange schreiten Minnesänger jetzt herbei; Ei, das gibt ein seltsam Streiten, Ein gar seltsames Turneil
Phantasie, die schäumend wilde, Ist des Minnesängers Pferd, Und die Kunst dient ihm zum Schilde Und das Wort, das ist sein Schwert.
Hübsche Damen schauen munter Vom beteppichten Balkon, Doch die Rechte ist nicht drunter Mit der rechten Lorbeerkron'.
Andre Leute, wenn sie springen In die Schranken, sind gesund; Doch wir Minnesänger bringen Dort schon mit die Todeswund'.
Und wem dort am besten dringet Liederblut aus Herzensgrund Der ist Sieger, der erringet Bestes Lob aus schönstem Mund.
* Heinrich Heine ( 1797 - 1856) Belsazer
Die Mitternacht zog näher schon; In stummer Ruh lag Babylon.
Nur oben in des Königs Schloss, Da flackert’s, da lärmt des Königs Tross.
Dort oben in dem Königssaal, Belsazer hielt sein Königsmahl.
Die Knechte saßen in schimmernden Reihn, Und leerten die Becher mit funkelndem Wein
Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht'; So klang es dem störrigen Könige recht.
Des Königs Wangen leuchten Glut; Im Wein erwuchs ihm kecker Mut.
Und blindlings reißt der Mut ihn fort; Und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort.
Und er brüstet sich frech und lästert wild! Die Knechtenschar ihm Beifall brüllt.
Der König rief mit stolzem Blick; Der Diener eilt und kehrt zurück.
Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt; Das war aus dem Tempel Jehovah's geraubt.
Und der König ergriff mit frevler Hand Einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand.
Und er leert ihn hastig bis auf den Grund. Und rufet laut mit schäumendem Mund:
„Jehovah! dir künd ich auf ewig Hohn, - Ich bin der König von Babylon!"
Doch kaum das grause Wort verklang, Dem König wards heimlich im Busen bang.
Das gellende Lachen verstummte zumal; Es wurde leichenstill im Saal.
Und sieh! und sieh! an weißer Wand Da kam's hervor, wie Menschenhand;
Und schrieb/ und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer/ und schrieb und schwand.
Der König stieren Blicks da saß, Mit schlotternden Knien und totenblass.
Die Knechtenschar saß kalt durchgraut, Und saß gar still, gab keinen Laut.
Die Magier kamen, doch keiner verstand Zu deuten die Flammenschrift an der Wand.
Belsazer ward aber in selbiger Nacht Von seinen Knechten umgebracht.
* Schauerballenden-Parodie
Heinrich Heine (1797 - 1856) Die Fensterschau
Der bleiche Heinrich ging vorbei, Schön Hedwig lag am Fenster. Sie sprach halblaut: „Gott steh' mir bei, Der unten schaut bleich wie Gespenster!"
Der unten erhob sein Aug' in die Höh', Hinschmachtend nach Hedewig's Fenster. Schön Hedwig ergriff es wie Liebesweh, Auch sie ward bleich wie Gespenster.
Schön Hedwig stand nun mit Liebesharm Tagtäglich lauernd am Fenster. Bald aber lag sie in Heinrich's Arm, Allnächtlich zur Zeit der Gespenster.
Theorie: Romanze
Begriff: lat. Romanice cantare; spanisch: romance - bezogen auf handlungsgefüllte Erzähllieder - In Deutschland vertraut geworden durch Gleim und Herder
Form: episches Gedicht, vierhebige Trochäen (Faller) , ungereimt, aber assonierend, (= auf Assonanzen, nicht auf Reime als Versausgang gestützt) und dadurch formal von der Ballade gut zu unterscheiden)
Thema: Naturmagie, Gefährdung der Alltagswirklichkeit durch naturmagische Phänomene - weniger düster als das Erzählgedicht, mit meist versöhnlichem inhaltlichen Ende Lyrikschadchens - PDF Romanzen
|
|
|
|||
|
|
|||