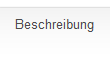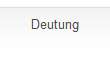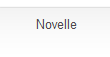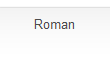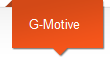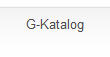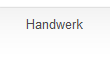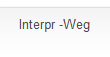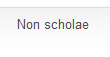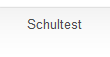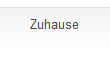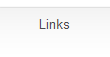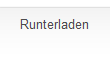|
|
|
|
|
Zorn - Kälte - Trauer
Walther von der Vogelweide (ca. 1170 – 1230) Alterslieder
1 Fro Welt, ir sult dem wirte sagen daz ich im gar vergolten habe. min groziu gülte ist abe geslagen, daz er mich von dem brieve schabe. swer ime iht sol, der mac wol sorgen. e ich im lange schuldic waere, ich wolt e zeinem Juden borgen. er swiget unz an einen tac: so wil er danne ein wette han, so jener niht vergelten mac. 2 „Walther, du zürnest ane not, du solt bi mir beliben hie. gedenke wie ich dirz erbot, waz ich dir dines willen lie, als dicke du mich sere baete. mir was vil innecliche leit daz du daz ie so selten taete. bedenke dich, din leben ist guot. so du mir rehte widersagest, so wirst du niemer wol gemuot.“ 3 Fro Welt, ich han ze vil gesogen, ich wil entwonen, des ist zit. din zart hat mich vil nach betrogen, wand er vil süezer fröiden git. do ich dich gesach reht under ougen, do was din schoene an ze schouwen wünneclich al sunder lougen. doch was der schanden alse vil, do ich dich hinden wart gewar, daz ich dich iemer schelten wil. 4 „Sit ich dich niht erwenden mac, so tuo doch ein dino des ich ger. gedenke an manegen liebten tac, und sich doch underwilent her, niuwan so dich der zit betrage." daz taet ich wunderlichen gerne, wan deich fürhte dine lage, vor der sich nieman kan bewarn. got gebe iu, frowe, guote naht, ich wil ze hereberge varn.
1 Frau Welt, das könnt ihr dem Wirt ruhig ausrichten – meinerseits ist alles beglichen. Meine große Schuld hat sich erledigt er kann mich aus seiner Liste streichen. All seine Schuldner mögen sich sorgen. Bevor ich ihm länger was schuldig blieb, würde ich eher ‘nen Geldverleiher anpumpen. Der mahnt nicht ständig – nur wenn es zu Ende geht besteht er auf seinem Pfand, falls man nicht bezahlen kann. 2 „Walther, du regst dich grundlos auf! Bleib hier lieber bei mir. Mach dir klar, was ich dir geboten habe und wie ich dir zur Verfügung stand sooft du mich angebettelt hast. Ich habe es sogar bedauert, dass das deinerseits so selten war. Besinn dich – das Leben ist doch nicht schlecht hier. Wenn du hier endgültig mit mir brichst, dann wirst du nie wieder gut gelaunt sein.“ 3 Frau Welt, ich hab dich zu lange konsumiert: Ich will mich abnabeln, es wird höchste Zeit! Deine Zärtlichkeit hat mich fast vernichtet denn sie schenkt süße Verlorenheiten. Als ich dir Auge in Auge gegenüberstand Kam mir deine Schönheit in den Blick - herrlich und unbestreitbar. Doch einfach schauderhaft als ich deine Kehrseite erkannte - seitdem möcht ich dich nur noch beschimpfen. 4 „Da ich dich nun nicht umstimmen kann so erfüll mir doch wenigstens eine Bitte: Behalt in Erinnerung so manch herrlichen Tag und schau mal gelegentlich wieder herein wenn dir die Zeit langweilig wird.“ Das täte ich außerordentlich gerne, gäbe es da nicht die Angst vor deinen Hintergedanken vor denen niemand sicher sein kann. Gott schenke euch, gute Frau, eine geruhsame Nacht. Ich meinerseits mach mich auf den Heimweg.
Adaption: Lyrikschadchen © * Christian Schubart (1739 - 1791) Morgenlied eines Gefangenen
Walt's Gott, der Tag bricht wieder an, Und weckt mich aus der Ruh'; Wohlauf, betritt die Dornenbahn! Du, meine Seele, du!
Da neben meinem Bette steht Mein Kreuz, ich nehm es auf, Und schick' ein weinendes Gebet Zum lieben Gott hinauf.
Er wird mir's tragen helfen, ach! Ich weiß es, Gott ist gut; Unmächtig bin ich, krank und schwach, Er aber giebt mir Muth;
Daß mich die Hoffnung nicht verläßt, Geduld nicht von mir weicht, Wenn Langeweile, wie die Pest, Im Finstern mich beschleicht.
Wenn Schwermuth meine Seele drück, Wenn jede Nerve dröhnt, Wenn Satan spöttisch auf mich blickt, Und meinen Glauben höhnt.
Wenn mich es martert, daß die Welt So schimpflich mich verwarf, Und wenn mir eine Thrän' entfällt, Weil ich nicht reden darf.
Nicht reden darf mit einem Freund, Nicht scherzen mit dem Kind, Soll schweigen, wie ein Menschenfeind, Wenn Brüder um mich sind.
Wenn meine Zelle stumm und todt Mir Brust und Geist verengt, Und wenn wie Blut das Morgenroth An meinen Wänden hängt;
Wenn fürchterlich das Kerkerschloß Klirrt in mein Morgenlied, Und wenn mein Aug' im Felsenschooß Nur Elend um sich sieht:
So weiß ich, Gott im Himmel giebt Mir Armen wieder Muth, Denn er, der die Verlaßnen liebt, Ist mir Verlaßnen gut.
Und so im Namen Jesu tret` Ich auf die Dornenbahn, Und glaub' und hoff , und les' und bet', Und sing', so gut ich kann.
Bald kommt ein Tag, der mich befreit Aus meinem Angstgedräng, Nur Freiheit macht die Seele weit, Und Knechtschaft macht sie eng.
Dann preis' ich dich im weiten Raum, Dich, Helfer in der Noth, Und halte ohne Zwang und Zaum Dein göttliches Gebot.
* Christian Schubart (1739 - 1791) Die FürstengruftDa liegen sie, die stolzen Fürstentrümmer, Ehmals die Götzen ihre Welt! Da liegen sie, vom fürchterlichen Schimmer Des blassen Tags erhellt!
Die alten Särge leuchten in der dunkeln Verwesungsgruft, wie faules Holz; Wie matt die großen Silberschilde funkeln, Der Fürsten letzter Stolz!
Entsetzen packt den Wandrer hier am Haare, Geußt Schauer über seine Haut, Wo Eitelkeit, gelehnt an eine Bahre, Aus hohlen Augen schaut.
Wie fürchterlich ist hier des Nachhalls Stimme! Ein Zehentritt stört seine Ruh'. Kein Wetter Gottes spricht mit lauterm Grimme: O Mensch, wie klein bist du!
Denn ach! hier liegt der edle Fürst, der gute! Zum Völkersegen einst gesandt, Wie der, den Gott zur Nationenruthe Im Zorn zusammenband.
An ihren Urnen weinen Marmorgeister; Doch kalte Thränen nur, von Stein, Und lachend grub, vielleicht ein welscher Meister, Sie einst dem Marmor ein.
Da liegen Schädel mit verloschnen Blicken, Die ehmals hoch herabgedroht, Der Menschheit Schrecken! - denn an ihrem Nicken Hing Leben oder Tod.
Nun ist die Hand herabgefault zum Knochen, Die oft mit kaltem Federzug Den Weisen, der am Thron zu laut gesprochen, In harte Fesseln schlug.
Zum Todtenbein ist nun die Brust geworden, Einst eingehüllt in Goldgewand, Daran ein Stern und ein entweihter Orden, Wie zween Kometen stand.
Vertrocknet und verschrumpft sind die Kanäle, Drinn geiles Blut, wie Feuer floß, Das schäumend Gift der Unschuld in die Seele, Wie in den Körper goß.
Sprecht Höflinge, mit Ehrfurcht auf der Lippe, Nun Schmeichelei'n ins taube Ohr! - Beräuchert das durchlauchtige Gerippe Mit Weihrauch, wie zuvor!
Er steht nicht auf, euch Beifall zuzulächeln, Und wiehert keine Zoten mehr, Damit geschminkte Zofen ihn befächeln, Schamlos und geil, wie er.
Sie liegen nun, den eisern Schlaf zu schlafen, Die Menschengeisseln, unbetraurt, Im Felsengrab, verächtlicher als Sklaven, Im Kerker eingemaurt.
Sie, die im ehrnen Busen niemals fühlten Die Schrecken der Religion, Und Gottgeschaffne, bessre Menschen hielten Für Vieh, bestimmt zur Frohn;
Die das Gewissen, jenen mächt'gen Kläger, Der alle Schulden niederschreibt, Durch Trommelschlag, durch welsche Trillerschläger Und Jagdlärm übertäubt;
Die Hunde nur und Pferd' und fremde Dirnen Mit Gnade lohnten, und Genie Und Weisheit darben liessen; denn das Zürnen Der Geister schreckte sie.
Die hegen nun in dieser Schauergrotte Mit Staub und Würmern zugedeckt, So stumm! so ruhmlos! noch von keinem Gotte Ins Leben aufgeweckt.
Weckt sie nur nicht mit eurem bangen Aechzen Ihr Schaaren, die sie arm gemacht, Verscheucht die Raben, daß von ihrem Krächzen Kein Wüthrich hier erwacht!
Hier klatsche nicht des armen Landmanns Peitsche, Die Nachts das Wild vom Acker scheucht! An diesem Gitter weile nicht der Deutsche, Der siech vorüberkeucht!
Hier heule nicht der bleiche Waisenknabe, Dem ein Tyrann den Vater nahm; Nie fluche hier der Krüppel an dem Stabe, Von fremdem Solde lahm.
Damit die Quäler nicht – zu früh erwachen, Seyd menschlicher, erweckt sie nicht. Ha! Früh genug wird ihnen krachen Der Donner am Gericht.
Wo Todesengel nach Tyrannen greifen, Wenn sie im Grimm der Richter weckt, Und ihre Gräul zu einem Berge häufen, Der flammend sie bedeckt.
Ihr aber, bessre Fürsten, schlummert süße Im Nachtgewölbe dieser Gruft! Schon wandelt euer Geist im Paradiese, Gehüllt in Blüthenduft.
Jauchzt nur entgegen jenem großen Tage, Der aller Fürsten Thaten wiegt, Wie Sternenklang tönt euch des Richters Wage, Drauf eure Tugend liegt.
Ach, unterm Lispel eurer frohen Brüder Ihr habt sie satt und froh gemacht, Wird eure volle Schale sinken nieder, Wenn ihr zum Lohn erwacht.
Wie wird's euch seyn, wenn ihr vom Sonnenthrone Des Richters Stimme wandeln hört: »Ihr Brüder, nehmt auf ewig hin die Krone, Ihr seyd zu herrschen werth.
* Gottfried August Bürger (1747 – 1794) Der Bauer an seinen durchlauchtigten Tyrannen
Wer bist du, Fürst, dass ohne Scheu Zerrollen mich dein Wagenrad. Zerschlagen darf dein Ross?
Wer bist du Fürst, dass in mein Fleisch Dein Freund, dein Jagdhund, ungebleut Darf Klau und Rachen haun?
Wer bist du, dass durch Saat und Frost Das Hurra deiner Jagd mich treibt, Entatmet wie das Wild? –
Die Saat, so deine Jagd zertritt, Was Ross und Hund und du verschlingst, Das Brot, du Fürst, ist mein.
Du Fürst hast nicht bei Egg und Pflug, Hast nicht den Erntetag durchschwitzt. Mein, mein ist Fleiß und Brot! –
Ha! Du wärst Obrigkeit von Gott? Gott spendet Segen aus; du raubst! Du nicht von Gott, Tyrann! (1778) * Justinus Kerner (1786 - 1862) Der Zopf 1im Kopfe
Einst hat man das Haar frisiert, Hat’s gepudert und geschmiert, Dass es stattlich glänze, Steif die Stirne begrenze.
Nun lässt schlicht man wohl das Haar, Doch dafür wird wunderbar Das Gehirn frisieret, Meisterlich dressieret.
Auf dem Kopfe die Frisur, Ist sie wohl ganz Unnatur, Scheint mir doch passabel, Nicht so miserabel,
Als jetzt im Gehirn der Zopf, Als jetzt die Frisur im Kopf, Puder und Pomade Im Gehirn! — Gott Gnade!
1 streng geknotete, eingefettete Haartracht und Modevorschrift für Männer im 18.Jh. - darauf setze man dann als Kopfbedeckung den „Dreispitz“; von Kerner sarkastisch kritisiert hier: die politische Zensur der Intellektuellen, der Schriftsteller
Heinrich Heine (1797 – 1856) Die schlesischen Weber
Im düstern Auge keine Träne, Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne: Deutschland, wir weben dein Leichentuch, Wir weben hinein den dreifachen Fluch – Wir weben, wir weben!
Ein Fluch den Gotte, zu dem wir gebeten In Winterskälte und Hungersnöten; Wir haben vergebens gehofft und geharrt, Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt – Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem König, dem König der Reichen, Den unser Elend nicht konnte erweichen, Der den letzten Groschen von uns erpresst Und uns wie Hunde erschießen lässt – Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem falschen Vaterlande, Wo nur gedeihen Schmach und Schande, Wo jede Blume früh geknickt, Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt – Wir weben, wir weben! Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht, Wir weben emsig Tag und Nacht – Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch, Wir weben hinein den dreifachen Fluch, Wir weben, wir weben! (1844) Anm.: Der Aufstand der schlesischen Weber 1844 gegen Fabrikbesitzer wurde vom preußischen Militär blutig niedergeschlagen.
August H. Hoffmann von Fallersleben (1798 – 1874) Das Lied vom deutschen Philister
Melodie: Wohlauf, noch getrunken den funkelnden Wein.
Der deutsche Philister das bleibet der Mann, Auf den die Regierung vertrauen noch kann, Der passet zu ihren Beglückungsideen, Der lässt mit sich alles gutwillig geschehn. Juvivallera, juvivallera, juvivalle ralle ralle ra!
Befohlenermaßen ist stets er bereit, Zu stören, zu hemmen den Fortschritt der Zeit, Zu hassen ein jegliches freie Gemüt Und alles was lebet, was grünet und blüht.
Sprich, deutsche Geschichte, bericht es der Welt, Wer war doch dein größter, berühmtester Held? Der deutsche Philister, der deutscheste Mann, Der alles verdirbet, was man Gutes begann.
Was schön und erhaben, was wahr ist und recht, Das kann er nicht leiden, das findet er schlecht. So ganz wie er selbst ist, so kläglich, gemein, Hausbacken und ledern soll alles auch sein.
Solang' der Philister regieret das Land, Ist jeglicher Fortschritt daraus wie verbannt: Denn dieses erbärmliche feige Geschlecht, Das kennet nicht Ehre, nicht Tugend und Recht.
Du Sklav' der Gewohnheit, du Knecht der Gewalt, O käme dein Simson, o kam' er doch bald l Du deutscher Philister, du grässlichste Qual, O holte der Teufel dich endlich einmal!
Doch leider hat Beelzebub keinen Geschmack An unsern Philistern, dem lumpigen Pack, Und wollten sie selber hinein in sein Haus, So schmiss' er die Kerle zum Fenster hinaus.
Entstanden 8. Juni 1843. Erster Druck: Deutsche Salonlieder, 1844. * Ferdinand Freiligrath (1810 – 1876) Trotz alledem!
Ob Armut euer Los auch sei, Hebt hoch die Stirn, trotz alledem! Geht kühn den feigen Knecht vorbei; Wagt's, arm zu sein trotz alledem! Trotz alledem und alledem, Trotz niederm Plack und alledem, Der Rang ist das Gepräge nur, Der Mann das Gold trotz alledem!
Und sitzt ihr auch beim kargen Mahl In Zwilch und Lein 1 und alledem, Gönnt Schurken Samt und Goldpokal - Ein Mann ist Mann trotz alledem! Trotz alledem und alledem, Trotz Prunk und Pracht und alledem! D er brave Mann, wie dürftig auch, Ist König doch trotz alledem!
Heißt „gnäd'ger Herr" das Bürschchen dort, Man sieht's am Stolz und alledem; Doch lenkt auch Hunderte sein Wort, 's ist nur ein Tropf trotz alledem! Trotz alledem und alledem! Trotz Band und Stern3 und alledem! Der Mann von unabhängigem Sinn Sieht zu, und lacht zu alledem!
Ein Fürst macht Ritter, wenn er spricht, Mit Sporn und Schild und alledem: Den braven Mann kreiert er nicht, Der steht zu hoch trotz alledem: Trotz alledem und alledem! Trotz Würdenschnack und alledem - Des innern Wertes stolz Gefühl Läuft doch den Rang ab alledem!
Drum jeder fleh', daß es gescheh', Wie es geschieht trotz alledem, Daß Wert und Kern, so nah wie fern, Den Sieg erringt trotz alledem! Trotz alledem und alledem, Es kommt dazu trotz alledem, Daß rings der Mensch die Bruderhand Dem Menschen reicht trotz alledem!
1 Zwilch und Lein: raues, derbes Baumwollgewebe und Leinen 2 Band und Stern: Ordensstern am Band Der Text entstand nach einem Lied des schottischen Dichters Robert Burns; Freiligraths Lied wurde 1844 vor Veröffentlichung in der „Kölnischen Zeitung" von der Zensur gestrichen. * Georg Herwegh (1817 - 1875) Auf die Leiche eines Regenten
Seyd ihr, Götter dieser Erde, seyd ihr Menschenstaub, wie wir? O! so zittert! Der Gefährte Eurer Größe lieget hier. Steigt von goldnen Stufen nieder Zu den Särgen eurer Brüder; Denkt beim Leichenpompe heut Auch an eure Sterblichkeit.
Habt ihr, wenn der junge Waise, Vor euch klagte, auch gehört? Und den fetten Bauch vom Schweiße Einer Wittwe nie genährt? Seyd ihr willig, reiche Sklaven Schwarzer Laster zu bestrafen? Helft ihr auch dem Tugendfreund, Wann er hülflos vor euch weint?
Fröhnt ihr selber nicht den Lüsten, Die ihr scharf an andern straft? Seyd ihr Bürger, seyd ihr Christen? Seyd ihr weis' und tugendhaft? Sieht man nie von stolzen Höhen Euch verächtlich niedersehen? Kennt ihr eure Ritterpflicht? O! so kommt, und zittert nicht.
Denn hier schlummert ein Regente, Der Verlaß'nen Gutes that, Und die richterlichen Hände Nie mit Blut gefärbet hat; Der auf Lasterthaten blitzte Und der Wittwen Recht beschützte; Der dem Waisen und der Noth Willig seine Hände bot.
Unpartheyisch, wie der Sonne Warmer, segenschwangrer Strahl, Der den Eichen strömet Wonne, Wie dem Veilchen in dem Thal, Strahlt' von seines Stuhles Höhen Allgemeines Wohlergehen In der Reichen Marmorhaus, Wie in arme Hütten aus.
Noch in halbentnervten Händen Trug er den Regentenstab, Und das Schwert an schlaffen Lenden, Das Gerechtigkeit ihm gab. Und, wie Helden, wenn sie sterben, Sprach er, ohne zu entfärben: Gott, hier ist die schwere Last, Die du mir vertrauet hast.
Aufgelöst in Thränen schwanken Arme hinter seiner Bahr; Stimmen der Verlaßnen danken Ihm, der ihre Stütze war. Goldne Zierde deines Standes, Vater unsers Vaterlandes, Unser unerkauftes Ach! Fliege deiner Seele nach.
Große, hebt die Angesichter Ueber jene Sternenbahn! Dorten trefft ihr euren Richter, Wie der ärmste Bettler, an; Ihn, vor dessen Ungewittern Auch der Cedern Wipfel zittern. Drum so übt noch in der Zeit Tugend und Gerechtigkeit *
Georg Weerth (1822-1856) Das Hungerlied Verehrter Herr und König,
Weißt du die schlimme Geschicht? Am Montag aßen wir wenig, Und am Dienstag aßen wir nicht.
Und am Mittwoch mußten wir darben, Und am Donnerstag litten wir Not; Und ach, am Freitag starben Wir fast den Hungertod!
Drum laß am Samstag backen Das Brot, fein säuberlich – Sonst werden wir sonntags packen Und fressen, o König, dich! (1845) * Georg Weerth (1822-1856) Die rheinischen Weinbauern
An Ahr und Mosel glänzten Die Trauben gelb und rot; Die dummen Bauern meinten, Sie wären aus jeder Not.
Da kamen die Handelsleute Herüber aus aller Welt; „Wir nehmen ein Drittel der Ernte Für unser geliehenes Geld!“
Da kamen die Herren Beamten Aus Koblenz und aus Köln; „Das zweite Drittel gehöret Dem Staate an Steuern und Zölln!“
Und als die Bauern flehten Zu Gott in höchster Pein, Da schickt er ein Hageln und Wettern Und brüllte:“ Der Rest ist mein!“
Viel Leid geschiehet jetzunder, Viel Leid und Hohn und Spott, Und wen der Teufel nicht peinigt, Den peinigt der liebe Gott!
* Georg Weerth (1822-1856) Die hundert Männer von Haswell
Die hundert Männer von Haswell, Die starben an einem Tag; Die starben zu einer Stunde; Die starben auf einem Schlag.
Und als sie still begraben, Da kamen wohl hundert Fraun; Wohl hundert Fraun von Haswell, Gar kläglich anzuschaun.
Sie kamen mit ihren Kindern, Sie kamen mit Tochter und Sohn; „Du reicher Herrn von Haswell, Nun gib uns unsern Lohn!“
Der reiche Herr von Haswell, Der stand nicht lange an; Er zahlte wohl den Wochenlohn Für jeden gestorbenen Mann.
Und als der Lohn bezahlet, Da schloss er die Kiste zu. Die eisernen Riegel klangen, Die Weiber weinten dazu.
Der Text besieht sich auf ein durch Nachlässigkeit der Grubenbesitzer mit zu verantwortendes Unglück in den Kohlengruben zu Haswell Colliery (Durham), September 1844, bei dem 98 Bergleute ums Leben kamen *
Else Lasker -Schüler (1869 -1945) Weltende
Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wär, und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet grabesschwer. Komm, wir wollen uns näher verbergen... Das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen. Du! Wir wollen uns tief küssen - Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen. (1905)
(Lasker - Schüler: Nicht nur für Schachspieler ist der Name Lasker ein Begriff; meine uneingeschränkte Bewunderung für die Gedichte und ihren Mut zum teppichorientierten Kleidungssti! Else, endlich copyfrei!- Oskar Loerke (1884 1941) Blauer Abend in Berlin
Der Himmel fließt in steinernen Kanälen; Denn zu Kanälen steilrecht ausgehauen Sind alle Straßen, voll vom Himmelblauen; Und Kuppeln gleichen Bojen, Schlote Pfählen
Im Wasser. Schwarze Essendämpfe* schwelen Und sind wie Wasserpflanzen anzuschauen. Die Leben, die sich ganz am Grunde stauen, Beginnen sacht vom Himmel zu erzählen,
Gemengt, entwirrt nach blauen Melodien. Wie eines Wassers Bodensatz und Tand Regt sie des Wassers Wille und Verstand
Im Dünen, Kommen, Gehen, Gleiten, Ziehen. Die Menschen sind wie grober, bunter Sand Im linden Spiel der großen Wellenhand.
*Anm.: die Esse, n (Schornstein) * Gustav Sack (1885 1916; gefallen in Bukarest) Der Schrei
Aus dieser steingewordenen Not, aus dieser Wut nach Brunst und Brot,
aus dieser lauten Totenstadt, die sich mir aufgelagert hat
härter als Erz, schwerer als Blei, steigt meine Sehnsucht wie ein Schrei
quellend empor nach Meer und Weiten und ungeheuren Einsamkeiten,
aus all dem Staub und Schmutz und Gewimmel nach einem grenzenlosen Himmel. (1917) *
Jakob van Hoddis (1887 1942, von den Nazis ermordet) Weltende
Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei, Und an den Küsten liest man steigt die Flut.
Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.
(1911) Anm.: Der Text galt im Expressionismus als “Programm” der Literaten. * Georg Heym (1887 - 1912. ertrunken in der Havel) Die Vorstadt
In ihrem Viertel, in dem Gassenkot, Wo sich der große Mond durch Dünste drängt, Und sinkend an dem niedern Himmel hängt, Ein ungeheurer Schädel, weiß und tot,
Da sitzen sie die warme Sommernacht Vor ihrer Höhlen schwarzer Unterwelt, Im Lumpenzeuge, das vor Staub zerfällt Und aufgeblähte Leiber sehen macht.
Hier klafft ein Maul, das zahnlos auf sich reißt. Hier hebt sich zweier Arme schwarzer Stumpf. Ein Irrer lallt die hohlen Lieder dumpf, Wo hockt ein Greis, des Schädel Aussatz weißt.
Es spielen Kinder, denen früh man brach Die Gliederchen. Sie springen an den Krücken Wie Flöhe weit und humpeln voll Entzücken Um einen Pfennig einem Fremden nach.
Aus einem Keller kommt ein Fischgeruch, Wo Bettler starren auf die Gräten böse. Sie füttern einen Blinden mit Gekröse. Er speit es auf das schwarze Hemdentuch.
Bei alten Weibern löschen ihre Lust Die Greise unten, trüb im Lampenschimmer, Aus morschen Wiegen schallt das Schreien immer Der magren Kinder noch der welken Brust.
Ein Blinder dreht auf schwarzem, großem Bette Den Leierkasten zu der Carmagnole*, Die tanzt ein Lahmer mit verbundener Sohle. Hell klappert in der Hand die Kastagnette.
Uraltes Volk schwankt aus den tiefen Löchern, An ihre Stirn Laternen vorgebunden. Bergmännern gleich, die alten Vagabunden. Um einen Stock die Hände, dürr und knöchern.
Auf Morgen geht's. Die hellen Glöckchen wimmern Zur Armesündermette** durch die Nacht. Ein Tor geht auf. In seinem Dunkel schimmern Eunuchenköpfe, faltig und verwacht.
Vor steilen Stufen schwankt des Wirtes Fahne, Ein Totenkopf mit zwei gekreuzten Knochen. Man sieht die Schläfer ruhn, wo sie gebrochen Um sich herum die höllischen Arkane.***
Am Mauertor, in Krüppeleitelkeit Bläht sich ein Zwerg in rotem Seidenrocke, Er schaut hinauf zur grünen Himmelsglocke, Wo lautlos ziehn die Meteore weit. (1910) * Carmagnole = französisches Revolutionslied ** Mette = Messe; Gottesdienst *** arcanum = Geheimmittel, Geheimnis * Alfred Lichtenstein (1889 1914 ; gefallen an der Somme) Trüber Abend
Der Himmel ist verheult und melancholisch. Nur fern, wo seine faulen Dünste platzen, Gießt grüner Schein herab. Ganz diabolisch Gedunsen sind die Häuser, graue Fratzen.
Vergilbte Lichter fangen an zu glänzen. Mit Frau und Kindern döst ein feister Vater Bemalte Weiber üben sich in Tänzen. Verzerrte Mimen schreiten zum Theater.
Spaßmacher kreischen, böse Menschenkenner. Der Tag ist tot... Und übrig bleibt ein Name! In Mädchenaugen schimmern kräftge Männer. Zu der Geliebten sehnt sich eine Dame. (1912)
Ernst Wilhelm Lotz (1890 – 1914; gefallen an der Westfront) Die Nächte explodieren in den Städten
Die Nächte explodieren in den Städten, Wir sind zerfetzt vom wilden, heißen Licht, Und unsre Nerven flattern irre Fäden, Im Pflasterwind, der aus den Rädern bricht.
In Kaffeehäusern brannten jähe Stimmen Auf unsre Stirn und heizten jung das Blut. Wir flammten schon. Und suchen leise zu verglimmen, Weil wir noch furchtsam sind vor eigner Glut.
Wir schweben müßig durch die Tageszeiten, An hellen Ecken sprechen wir die Mädchen an. Wir fühlen noch zu viel die greisen Köstlichkeiten Der Liebe, die man leicht bezahlen kann.
Wir haben uns dem Tage übergeben Und treiben arglos spielend vor dem Wind, Wir sind sehr sicher, dorthin zu entschweben, Wo man uns braucht, wenn wir geworden sind.
* Marko Ferst @ Beute
Sie kannten die stille Botschaft der Handel florierte blendend was gab es schon groß auszurichten? die Mammutherden sind Geschichte auf den Marktplätzen wird Größenwahn als Meterware verramscht worauf kommt es nun noch an? der nächste Reichskanzler wird eine andere Uniform tragen die Beute war vorher schon verteilt der Sensenmann gelangt zu neuen Konjunkturen dagegen ist kein Glücksklee gewachsen so blieb alles bei seinem Gang * 7/2007
Marko Ferst @ Wellen branden
Nachts blinkt grell Spiegellicht von der Greifswalder Oie entfernter Inselturm Dreh um Dreh tags manchmal schwebt der Landfleck wie vom Meer abgehoben
Wellen brechen über Buhnen Fischdüfte ziehen entlang der Sanddüne geräuchertes Angebot in Schilfhütten Möven schnappen in der Luft Brotkrumen von Mädchenhand geworfen Algengrün schwemmt ins Strandweiß
Hoch oben vom Streckelsberg Schiffe erkunden Badespaß von Weitem die Fensteraugen der Blechpyramide Rettungsblicke sichern schräg rüber wird frisches Eis gezapft am Ende der Seebrücke eine zerfetzte Fahne Pizzafeuer wirbt für die Sicht übers Abendmeer auf den Anhöhen Wald entlang der Küste ein Lampenweg beleuchtetes Gitterweiß
Am schmalsten Landsteg zwischen Achterwasser und Meeresbriese ein ausrangierter S-Bahnwagen damit begann alles Otto Niemeyer-Holsteins Refugium er malte ins Ocker grauschwarze Bahnkreuze Eisbrüche am Strand blauweiß einst beim täglichen Gang sein Holzmast grüßt nicht mehr Farbpaletten und Pinsel auf verlassener Spur Koserow, Insel Usedom, 2009 Marko Ferst herzlich gedankt für die Abdruckerlaubnis - April 2010
Kein copyright - traurig?
Ilse Aichinger (1921 - 2016) Durch und durch (Wir sind alle/ nur für kurz hier eingefädelt) Ingeborg Bachmann (1926 – 1973) Reklame (Wohin aber gehen wir) Franz Josef Degenhardt (1931 - 2011) Macht euch nichts vor (. . . / Kumpanen, Sangesbrüder) Reiner Kunze (* 1933) wolf biermann singt (Im zimmer kreischt die straßenbahn) Wolf Biermann (* 1936) Großes Gebet der alten Kommunistin Oma Meume in Hamburg (Gott, lieber Gott im Himmel, hör mich betn) Claudio Lange (* 1944) Sklaverei (erst musst du ihm die rippen brechen) * Erich Adler © Bunte Nachricht (27. Jänner - 1998) Für Inge und Fredy in Maine Mitten im Schnee Bilder aus dem Sudan: Asche Körper verbrannte Erde rebelliert aus Hütte und Hungerleib
Ich sehe die greisen Kinder - Jiskor - Tränen frisch auf meinen Händen brennen Lenz über mein winterndes
Herz.
|
|
|
||||||||||||||||||